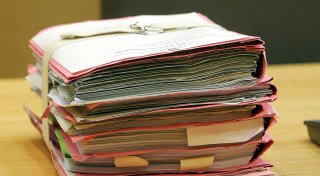Brüssel/Bad Oeynhausen. Ob Lebensmittel oder Baumaterial - täglich werden tausende Tonnen wichtiger Güter kreuz und quer durch Europa befördert, meist auf der Straße. Allein 2018 waren es laut Statistischem Bundesamt mehr als 3,2 Milliarden Tonnen Güter in Lkw. Zum Vergleich: Mit der Eisenbahn waren es gerade einmal etwas mehr 340 Millionen Tonnen.
Die Fahrer, die diese Waren in ihren Sattelzügen transportieren, sind bisweilen Tage und Wochen unterwegs, teils zu menschenunwürdigen Bedingungen. Viele von ihnen stammen aus Osteuropa. Firmen nutzen die finanzielle Not der Fahrer, die für einen geringen Lohn wochenlang in Mittel- und Westeuropa unterwegs sind, auf Parkplätzen ohne Sanitäranlagen campieren oder in ihren Fahrerkabinen übernachten.
Fahrer sollen mindestens alle vier Wochen nach Hause
Die Europäische Union reagierte im vergangenen Jahr mit dem sogenannten „Mobilitätspaket I", das die Arbeitsbedingungen der Fahrer verbessern und zugleich die Dumpingpreise einiger Anbieter am Markt beseitigen soll. Unter anderem schreibt das Paket vor, dass die reguläre Wochenruhezeit von mehr als 45 Stunden nicht mehr im Lkw oder auf Parkplätzen verbracht werden darf. Sofern der Fahrer nicht nach Hause zurückkehrt, sei die Ruhezeit „in geeigneten und geschlechtergerechten Unterkünften mit angemessenen Schlafgelegenheiten und sanitären Einrichtungen zu verbringen. Die Kosten für diese Unterbringung sind vom Arbeitgeber zu tragen", heißt es auf der Internetseite des Bundesverkehrsministeriums.
Ferner sollten die Fahrer mindestens alle vier Wochen nach Hause zurückkehren, die Fahrzeuge spätestens alle acht Wochen. Horst Kottmeyer, Spediteur aus Bad Oeynhausen und Aufsichtsratsvorsitzender des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, hält viel von dem Mobilitätspaket. „Das ist ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung." Die neuen Regeln hätten in der Branche bereits „für eine gewisse Unruhe gesorgt." Vor allem in den europäischen Ländern, in denen der Güterverkehr einen großen Anteil am Bruttosozialprodukt hat, etwa in Rumänien. „Da wird sich noch einiges tun", sagt Kottmeyer. „Die Umsetzung wird auch hoffentlich gut überwacht."
Kontrolldichte liegt seit Jahren bei unter einem Prozent
Das ist auch aus Sicht der Gewerkschaft Verdi ein entscheidendes Kriterium. Zwar könne das Mobilitätspaket die Situation der Fahrer verbessern, allerdings sei hierfür vor allem die Kontrolle wichtig, sagt Stefan Thyroke, Leiter der für Speditionen und Logistik zuständigen Verdi-Fachgruppe. So könne etwa die Überprüfung der Rückkehrverplichtung alle vier Wochen das „Ende des Nomadentums" bedeuten. Aber: „Die Kontrolldichte des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) liegt seit Jahren unter einem Prozent der Lkw-Fahrten", sagt Thyroke. Gemeinsame Kontrollen von BAG, Zoll und Polizei müssten viel öfter durchgeführt werden, um abschreckend und wirksam zu sein.
Volker Platz gehört zu den Unternehmern, die schon jetzt die Regeln einhalten, obwohl das Mobilitätspaket noch nicht in ein nationales Gesetz gegossen wurde. Platz ist Inhaber der AM Spedition aus Bad Salzuflen und hat sich auf Neumöbel- und Küchentransporte nach Großbritannien und Irland spezialisiert. „Die Touren sind so geplant, dass die Fahrer sonntags losfahren und freitags um 16 Uhr wieder auf dem Hof ankommen", sagt Platz. Die sechs polnischen Fahrer, die für die Spedition unterwegs sind, fahren alle zwei Wochen zurück in ihre Heimat.
Mehrere Staaten haben bereits Klagen eingereicht
Ganz anderer Meinung ist Stephan Westerfeld. Einen „zahnlosen Tiger" nennt der Spediteur aus Hüllhorst das Mobilitätspaket. Die Regeln seien gut gemeint, „der Wille ist aber nicht da, das zu ändern", sagt Westerfeld und schiebt hinterher: „Das ist Halbsklaventum, was da gemacht wird."
Denn das neue Mobilitätspaket habe Lücken. Auch die verkürzten Wochenendruhezeiten, mindestens 24 Stunden, könnten nach wie vor im Lkw verbracht werden. Osteuropäische Fahrer seien bisweilen mehrere Wochen ununterbrochen auf den Straßen unterwegs und lebten unter widrigsten Bedingungen. „Ein Fahrer hat sechs Wochen lang weniger Platz, als ein Huhn in der Mast", sagt Westerfeld, der eine politische Diskussion über die Größe oder Ausstattung von Fahrerhäusern für angebracht hält. Das bleibe aber auch beim Mobilitätspaket aus. „Die Hürden wurden etwas höher gehängt. Aber das ändert das Grundproblem nicht."
Auf internationaler Ebene wird das Mobilitätspaket bereits angefochten: Die EU-Mitgliedstaaten Polen, Litauen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Zypern und Malta haben jeweils Klagen gegen das Paket beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. In einer gemeinsamen Stellungnahme werden die Vorschriften des Pakets als protektionistisch bezeichnet. Die Regeln stünden nicht im Einklang mit dem EU-Recht und würden die Dienstleistungsfreiheit im europäischen Binnenmarkt beeinträchtigen.
KOMMENTAR DER REDAKTION
Die modernen Fernfahrernomaden auf europäischen Rastplätzen sind bittere Realität. Und das bereits seit Jahren. Immer wieder werden Fälle bekannt von Lkw-Fahrern, die unter unwürdigen Bedingungen auch hierzulande auf den Autobahnen unterwegs sind. Der Wahnsinn hat System.
Das hat strukturelle Gründe. Denn letztlich geht es, wie so oft, um den Preis. Der europäische Güterverkehr kann von osteuropäischen Briefkastenfirmen für‘n Appel und ‘n Ei angeboten werden, weil es Menschen gibt, die dafür rund um die Uhr arbeiten. Arbeiten müssen, um ihre Familie halbwegs zu ernähren. Das Lohngefälle zwischen einem deutschen und einem polnischen Fahrer etwa liegt bei 30 Prozent. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die vielfältigen Klagen am EuGH zeigen, dass ein größerer Teil der EU bisher kein Interesse an dringend nötigen Veränderungen hat. Damit wird ein Ausbeutersystem gedeckt, das abgeschafft gehört.
Dass die EU sich nun dieses Themas annimmt, ist gut. Aber: Eine Regelsammlung mit dem Etikett „Mobilitätspaket I" wird nicht reichen, um das Sozialdumping in Europa zu beseitigen. Es bedarf regelmäßiger und flächendeckender Kontrollen, ob die Regeln auch eingehalten werden. Es muss Firmen und Spediteuren finanziell weh tun, wenn sie ihre Fahrer wie moderne Leibeigene halten. Und es muss diesen Firmen klar sein, dass sie jederzeit dabei erwischt werden können.