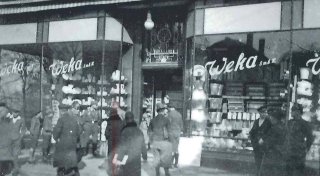Berlin/Bielefeld (epd). Anhänger von Verschwörungsmythen sind laut einer Untersuchung historisch oft weniger gut informiert und neigen stärker zu revisionistischen Perspektiven auf die Zeit des Nationalsozialismus. Zu diesem Ergebnis kommt der am Mittwoch in Berlin vorgestellte „Multidimensionale Erinnerungsmonitor MEMO 2021" der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft".
Der Konfliktforscher und einer der Studienautoren, Andreas Zick, von der Universität Bielefeld betonte, „dass Menschen, die Verschwörungserzählungen glauben, eher die Bevölkerung während der NS-Zeit von Verantwortung entlasten, das Leiden der NS-Opfer mit dem der Täter gleichsetzen und an der Verfolgung der Jüdinnen und Juden zweifeln".
Angesichts der Corona-Pandemie und der damit im Zusammenhang kursierenden Verschwörungserzählungen seien Corona-Leugner und andere Gruppen „eine neue Herausforderung für die Erinnerungs- und Gedenkkultur", sagte Zick.
So lehnen laut der Studie in Deutschland zwar drei Viertel (75,2 Prozent) der Befragten die Aussage ab, dass es berechtigt sei, das Leiden der deutschen Bevölkerung während der Corona-Pandemie mit dem Leid von Menschen während der NS-Zeit zu vergleichen. Allerdings stimmten 3,9 Prozent der Befragten dieser Aussage zu. Weitere 6,1 Prozent lehnten sie zumindest nicht ausdrücklich ab.
NS-Zeit - ein abgeschlossenes Kapitel?
MEMO 2021 hat unter anderem untersucht, welche Ereignisse seit 1945 die Befragten mit der NS-Geschichte in Verbindung bringen. Jeder Fünfte (20 Prozent) nennt auf diese Frage rechtsextremen Terror wie die Anschläge des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) oder den Anschlag in Hanau im vergangenen Jahr. 46 Prozent der Befragten geben auf die Frage nach Ereignissen mit NS-Bezug jedoch keine Antwort und sehen keine Verbindungen.
"Wir finden in unseren Studien wiederholt das Bild einer 'historisch sensibilisierten' Gesellschaft, das sich bei genauem Nachfragen aber nicht immer bestätigt. Das betrifft das konkrete Wissen über die NS-Zeit aber auch das Wissen um Kontinuitäten nationalsozialistischen Gedankenguts. Unser 'Geschichtsbewusstsein' sollte nicht 1945 enden, sondern die jüngere Vergangenheit und Gegenwart einbeziehen, wenn es unser Anspruch ist, aus der Geschichte zu lernen", sagt Projektkoordinator Michael Papendick.
INFORMATION
Der Erinnerungsmonitor MEMO untersucht seit 2017 anhand jährlicher repräsentativer Umfragen den Zustand der Erinnerungskultur in Deutschland. Für den Erinnerungsmonitor 2021 wurden zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 insgesamt 1.000 Menschen zwischen 16 und 87 Jahren befragt.
Links zum Thema
"Teufelskreis" aus Verschwörungsmythen: So gelang die Flucht aus dem Sog |NW+
Schwurbler und Verschwörungen – in der Welt der Corona-Mythen |NW+
Wie der Verfassungsschutz jetzt gegen Querdenken vorgehen kann |NW+
Verschwörungstheorien: "Wie Heldengeschichte, die man sich selbst erzählt" |NW+
Konfliktforscher Zick über Corona-Proteste: "Es wird zu Hasstaten kommen" |NW+