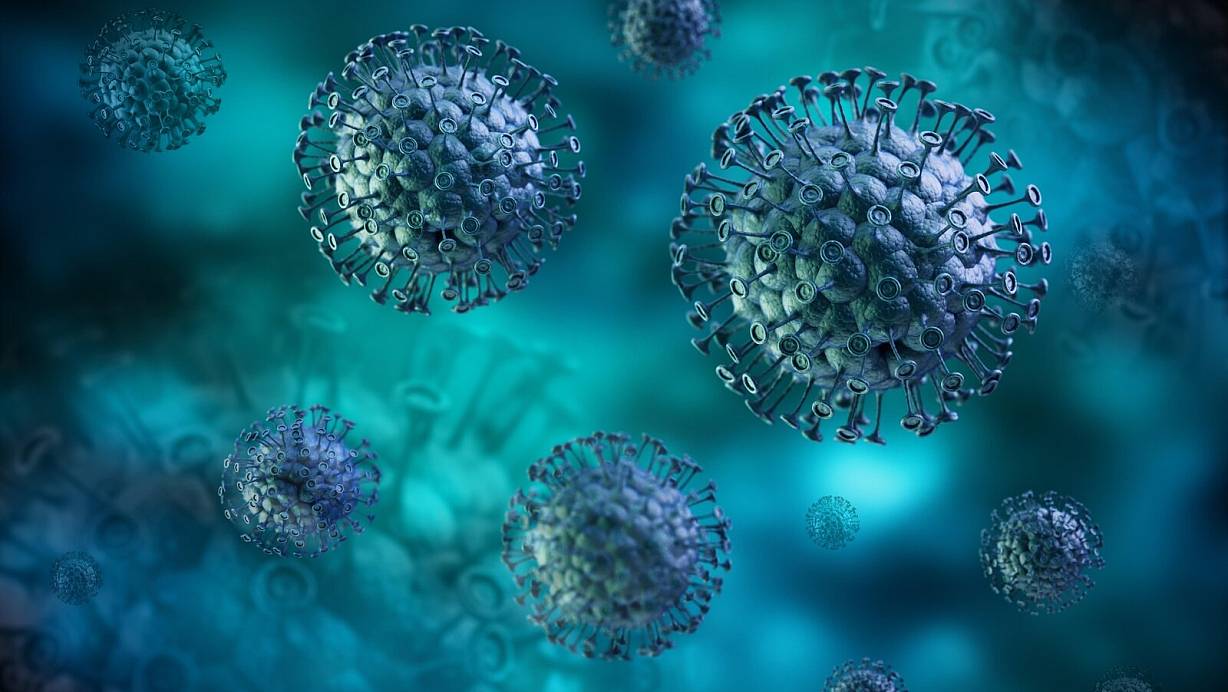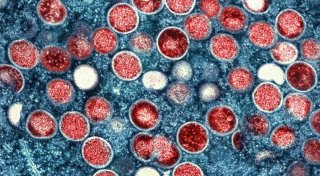Quarantäne, Hygiene und Arbeitsrecht: Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus im Überblick. Am Ende der Seite sehen Sie unsere aktuellen Grafiken aus der Region.
Was sind Coronaviren?
Die Viren sind vergleichsweise groß und haben eine Hülle. Dadurch sehen sie unter dem Elektronenmikroskop kronenförmig aus, was ihnen ihren Namen eingebracht hat (lateinisch: corona). Es gibt hunderte Arten, die sich bei Vermehrung verändern können, und somit in manchen Fällen auch von einer Art auf die andere übertragen werden können. Die Mehrzahl der Coronaviren wurde bei Tieren festgestellt. SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2) ist ein neues Beta-Coronavirus, das Anfang 2020 als Auslöser von Covid-19 identifiziert wurde.
Wie stark hat sich Sars-CoV-2 in Deutschland bislang ausgebreitet?
Inzwischen wurden laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) seit Pandemie-Beginn 35.784.912 Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland gemeldet (Stand: 4. November 2022). In NRW liegt diese Zahl bei über 7 Millionen Fällen. 154.328 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Infektion bundesweit gestorben - in NRW sind es 28.294 Menschen.
Wie äußert sich das Virus?
Dem RKI zufolge gehören zu den im deutschen Meldesystem am häufigsten erfassten Symptomen Husten, Fieber, Schnupfen, sowie Geruchs- und Geschmacksverlust. Die Krankheitsverläufe sind sehr unterschiedlich in Symptomatik und Schwere. Die Infektion kann ohne Symptome verlaufen, aber auch einen schweren Verlauf bis hin zu einer schweren Entzündung des Lungengewebes (Pneumonie) mit Lungenversagen und Tod zur Folge haben.
Wie gefährlich ist das Virus?
Die überwiegende Zahl der Corona-Erkrankungen verlaufen mild. Die Wahrscheinlichkeit für schwere und auch tödliche Krankheitsverläufe nimmt laut RKI mit zunehmendem Alter und bei bestehenden Vorerkrankungen zu. Das individuelle Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs lässt sich anhand der epidemiologischen/statistischen Daten nicht ableiten. So kann es auch ohne bekannte Vorerkrankungen und bei jungen Menschen zu schweren oder zu lebensbedrohlichen Verläufen kommen, die eine künstliche Beatmung erfordern. Langzeitfolgen sind auch nach leichten Erkrankungen möglich.
Zu den häufigsten Langzeitfolgen gehören nach Angaben des RKI Symptome wie Müdigkeit und Erschöpfung, Kopfschmerzen, Atembeschwerden, Geruchs- und Geschmacksstörungen, kognitive Einschränkungen (sogenannte brain fogs, Gehirnnebel), depressive Verstimmungen, Schlaf- und Angststörungen sowie Herzklopfen und Herzstolpern. Als weitere Symptome werden auch Brustschmerzen, Haarausfall, neu auftretende Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sowie Thromboembolien genannt.
Wer gehört zu den Risikogruppen?
Bei Risikogruppen treten schwere Krankheitsverkäufe häufiger auf. Dazu gehören Personen ab 50 Jahren, Raucher, Übergewichtige, Menschen mit Down-Syndrom sowie Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen wie einem geschwächten Immunsystem, Diabetes mellitus oder einer chronischen Lungenerkrankung. Auch Patienten mit unterdrücktem Immunsystem, beispielsweise aufgrund einer Erkrankung die mit Immunschwäche einhergeht, haben ein höheres Risiko.
Wie ansteckend ist das Coronavirus?
Ein Wert, wie viele andere Menschen ein Infizierter im Mittel ansteckt, lässt sich nicht gesichert angeben. Das Virus vermehrt sich im Rachen und verbreitet sich vor allem durch Tröpfchen etwa beim Husten, Sprechen, Niesen, Atmen und Singen. "Die fliegen vielleicht so eineinhalb Meter weit und fallen relativ schnell zu Boden", erklärt Virologe Christian Drosten. "Es ist das Einatmen einer solchen Wolke, die einen infiziert in den meisten Fällen." In Kontaktsituationen gibt es demnach ein Risiko - etwa, wenn man mit einem Infizierten ungefähr eine Viertelstunde oder länger gesprochen hat. Eine Übertagung durch Hände oder kontaminierte Oberflächen ist insbesondere in unmittelbarer Umgebung einer infektiösen Person nicht auszuschließen.
Die Wahrscheinlichkeit, schwer an Corona zu erkranken, ist durch eine vollständige Impfung nach Angaben des RKI um etwa 90 Prozent geringer als bei einer nicht geimpften Person. Trotz Covid-19-Impfung kann es generell noch zu einer Covid-Erkrankung kommen, da die Impfung laut RKI keinen hundertprozentigen Schutz bietet.
Welche Rolle spielen die neuen Varianten?
Weltweit werden verschiedene Varianten beobachtet, darunter besorgniserregende Varianten wie Alpha (B 1.1.7), Beta (B 1.135), Gamma (P1), Delta (B1.617.2) und seit November 2021 Omikron (B.1.1.529). Die bisher ergriffenen Infektionsschutzmaßnahmen und empfohlenen Verhaltensregeln (AHA+L, Kontaktreduktion) schützen auch vor Ansteckungen mit den Varianten, so das RKI. Den RKI-Daten aus dem Juli 2022 zufolge hat inzwischen seit Mitte Juni vorherrschende Omikron-Variante BA.5 in Deutschland alle anderen Varianten fast vollständig verdrängt.
Wie lang ist die Inkubationszeit?
Die Inkubationszeit, also der Zeitraum zwischen Ansteckung und Auftreten von Symptomen, beträgt in den meisten Fällen vier bis sechs Tage. Das hängt von der Coronavirus-Variante ab. Sie kann Studienerkenntnissen zufolge aber auch zehn bis 14 Tage betragen. Als sicher gilt, dass die Ansteckungsfähigkeit mit Ausbruch der Symptome am größten ist und mit dem Krankheitsverlauf geringer wird. Bei schweren Krankheitsverläufen und bei Vorliegen einer Immunschwäche können Patienten noch deutlich länger als zehn Tage nach Symptombeginn ansteckend sein.
Ist Covid-19 mit einer Grippe vergleichbar?
Beide sind von einem Virus verursachte Atemwegserkrankungen, deren Verlauf sehr unterschiedlich sein kann - von symptomlos oder mild bis hin zu sehr schwer, mitunter gar tödlich. Häufigste Symptome wie Husten, Fieber, Unwohlsein und Müdigkeit sind ebenfalls ähnlich. Beide Erreger werden vorwiegend über Tröpfchen etwa beim Sprechen oder Husten oder auch direkten Kontakt übertragen. Allerdings kann sich laut WHO Influenza (Grippe) rascher ausbreiten als Covid-19. Schwere bis lebensbedrohliche Verläufe gibt es nach bisherigen Auswertungen bei Covid-19 häufiger als bei der Grippe.
Welche Impfstoffe gegen das Coronavirus sind in der EU zugelassen?
Die Europäische Kommission hat inzwischen folgende Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen:
- Comirnaty (Biontech/Pfizer), seit dem 21.12.2020
- Valneva (Valneva Austria GmbH), seit dem 24.6.2022
- Janssen (Johnson & Johnson), seit dem 11.3.2021
- Nuvaxovid (Novavax), seit dem 20.12.2021
- Spikevax (Moderna), seit dem 6.1.2021
- Vaxzevria (Astrazeneca), seit dem 29.1.2021
Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ist seit dem 26. November 2021 der Kinder-Impfstoff von Biontech/Pfizer in der EU zugelassen. Auch von Spikevax ist eine Impfung für sechs- bis elfjährige Kinder zugelassen.
Wann sind andere Impfungen sinnvoll?
Die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie (DGG) ruft insbesondere alle Senioren dringend dazu auf, die Pneumokokkenimpfung nachzuholen sowie sich gegen die saisonale Grippe impfen zu lassen. Eine Pneumokokkenimpfung sei extrem wichtig, weil bei geimpften Patienten eine Lungenentzündung mit deutlich milderen Symptomen verlaufe als bei nicht geimpften Patienten, warnt die Gesellschaft für Geriatrie. Sie macht auch darauf aufmerksam, dass gar nicht der Coronavirus an sich fatal sei, sondern die sich daraus entwickelnde Lungenentzündung. Auch das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt Menschen im Alter von über 60 Jahren diese Impfung.
Mit welchen Medikamenten wird Covid-19 behandelt?
Im Juli 2020 erhielt das Arzneimittel Veklury (Wirkstoff Remdesivir) eine bedingte Zulassung in der Europäischen Union (EU) für die Therapie von Covid-19. Verwendet werden kann es bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren mit einer Lungenentzündung, die eine zusätzliche Sauerstoffzufuhr, aber keine invasive Beatmung benötigen.
Das Kortisonpräparats Dexamethason ist in einer Vielzahl von zugelassenen Arzneimitteln als Wirkstoff enthalten. Die medizinische Leitlinie empfiehlt den Einsatz des Kortisonpräparats auch zur Therapie von schwer erkrankten Covid-19-Patienten.
Monoklonale Antikörper (MAK) sind gegen das Virus gerichtet. Dabei handelt es sich um biotechnologisch hergestellte Antikörper, die das Andocken der Viren an Zellen verhindern und so die Infektion eindämmen sollen. Sie können können frühzeitig bei Betroffenen eingesetzt werden, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. In Deutschland können verschiedene monoklonale Antikörper zur Behandlung von Covid-19 eingesetzt werden, dazu zählt die Kombination Casivirimab/Imdevimab, die dem seit dem 12. November 2021 in der EU zugelassenen Medikament Ronapreve entspricht. Außerdem hat die Europäische Kommission im Dezember 2021 das Anwendungsgebiet von RoActemra (Tocilizumab) zur Behandlung von Erwachsenen mit schwerem COVID-19 erweitert.
Wie kann ich mich derzeit vor einer Ansteckung schützen?
Zu den wichtigsten Maßnahmen in der Bevölkerung zählen laut RKI Kontakte reduzieren, die AHA+L-Regeln beachten (Abstand halten, Hygiene, im Alltag Masken tragen und lüften) und bei akuten Atemwegssymptomen zu Hause bleiben. Diese Maßnahmen schützen auch vor Ansteckung mit den besorgniserregenden Varianten. Auch die Corona-Warn-App ist ein zusätzlicher, wichtiger Baustein der Pandemiebekämpfung.
Desinfektionsmittel sind im Heimgebrauch in der Regel nicht nötig. Helfen kann es, Umarmungen und Händeschütteln zu unterlassen und von vielen Menschen berührte Oberflächen wie Türklinken, Haltegriffe und Aufzugknöpfe nicht anzufassen. Handtücher oder Besteck, sowie Trinkflaschen oder ähnliches sollten nicht von mehreren Menschen gleichzeitig genutzt werden. Beim Aufenthalt in öffentlichen Räumen sollte man das Berühren der Nasenschleimhäute und das Reiben der Augen vermeiden, sagte der Greifswalder Hygienefacharzt Günter Kampf. "Das Virus will in die Atemwege." Zu Hause angekommen sollte man als erstes unbedingt die Hände gründlich waschen.
Auch wenn die Impfung keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Ansteckung bietet, kann dadurch das Risiko eines schweren Verlaufs minimiert werden.
Wie kann ich andere vor einer Ansteckung schützen?
Die wichtigsten Maßnahmen sind neben der Hust- und Nies-Etikette dieselben, die man auch für sich selbst treffen sollte. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat auf einer Info-Seite außerdem die wichtigsten Regeln für den Alltag gebündelt, um eine Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Das Land NRW rät: "Wenn Sie selbst jung und gesund sind, können Sie helfen, indem Sie besonders Schutzbedürftige unterstützen. [...] Je mehr Menschen sich an die Empfehlungen und Regeln halten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, die Ausbreitung des Virus einzugrenzen."
Was bringt das Tragen von Masken?
Eine korrekt getragene FFP2-Maske schützt, wie Untersuchungen ergaben. Eine Studie etwa des Max-Planck-Instituts in Göttingen untermauerte, dass korrekt getragene FFP2- oder KN95-Masken infektiöse Partikel besonders wirkungsvoll aus der Atemluft filtern - vor allem dann, wenn sie an den Rändern möglichst dicht abschließen.
Gilt eine Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen?
Seit dem 3. April 2022 gilt in NRW nur noch an wenigen Orten eine Maskenpflicht. Dazu zählen öffentliche Verkehrsmittel, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Obdachlosen- und Asylunterkünfte. Ansonsten wird das Tragen einer Maske in Innenräumen empfohlen, ist aber nicht verpflichtend.
Kann das Virus über Bargeld übertragen werden?
Die Wahrscheinlichkeit, sich an Geldscheinen oder Münzen mit dem Coronavirus zu infizieren, ist nach Einschätzung der Experten sehr gering. "Das auf dem Geldstück klebende Virus würde ich mal weitgehend vergessen", sagt dazu der Virologe Christian Drosten. Corona- und Influenzaviren seien behüllte Viren und damit gegen Eintrocknung "extrem empfindlich". Bei Coronaviren erfolge eine Infektion meist über den Rachen "und wir stecken uns den Finger nicht in den Hals", so Drosten. Deshalb spiele bei der aktuellen Coronavirus-Erkrankung die Kontaktübertragung eine geringere Rolle, als bei anderen Erkältungskrankheiten.
Wie erfahre ich, ob ich in ein bestimmtes Land reisen darf?
Hier sollten Reisende unbedingt die Internetseiten des Auswärtigen Amtes im Blick behalten. Dort findet man aktuelle Reisewarnungen für das Ausland. Hinweise zu Reisebeschränkungen innerhalb Deutschlands – etwa im Fall von Corona-Hotspots – finden sich auf den entsprechenden Internetseiten der jeweiligen Bundesländer.
Was tue ich, wenn ich fürchte, mich angesteckt zu haben?
Die Berliner Charité bietet einen Online-Fragebogen für die erste Abklärung der Wahrscheinlichkeit einer Infektion an. Danach: Auf keinen Fall direkt in eine Praxis oder Notaufnahme gehen. Eine Möglichkeit ist es, sich beim ersten Verdacht mit einem Selbsttest zuhause zu testen. Wer Symptome hat und - etwa wegen des Kontakts zu einem nachweislich Infizierten - befürchtet, an Covid-19 erkrankt zu sein, soll sich zunächst telefonisch bei seinem Hausarzt oder dem Gesundheitsamt melden. Dasselbe gilt für Kontaktpersonen von diagnostizierten Infektionsfällen - auch wenn noch keine Symptome erkennbar sind. Möglich ist es immer auch, die bundesweite Service-Telefonnummer 116 117 zu wählen.
Mit dem Hausarzt wird abgeklärt, ob ein PCR-Test notwendig ist und wo dieser durchgeführt werden kann.
Wie funktioniert ein Coronavirus-Test?
Beim Verdacht auf Sars-CoV-2 wird der Erreger in der Regel mit einem molekularbiologischen Test nachgewiesen. Zunächst nimmt ein Arzt eine Probe aus den Atemwegen eines Patienten - entweder einen Abstrich oder ausgehusteten Schleim. Spezialisten bereiten diese Probe dann im Labor auf und suchen mit einem sogenannten PCR-Test nach dem Erbmaterial des Virus. Vereinfacht gesagt wird dabei ein bestimmter Abschnitt des Viren-Erbguts millionenfach kopiert und farblich markiert. Diese Markierung kann sichtbar gemacht werden. Sind entsprechende Farbsignale vorhanden, handelt es sich um eine "positive Probe". Unter idealen Bedingungen dauert ein solcher Test im spezialisierten Labor (zum Beispiel in Bad Salzuflen) 3 bis 5 Stunden.
Neben dem PCR-Test gibt es zudem noch einen Antigen-Schnelltest, der von geschultem Personal durchgeführt wird. Seit März 2021 sind auch Selbsttests im Handel erhältlich. Wie beim PCR-Test wird ein Nasen- oder Rachenabstrich gemacht. Sie liefern deutlich schneller, in der Regel nach maximal 15 Minuten, ein Testergebnis.
Was tue ich, wenn ich infiziert bin?
Um Infektionsketten verlässlich zu unterbrechen, empfiehlt das Robert Koch-Institut nachweislich Infizierten eine Unterbringung in "häuslicher Quarantäne". Personen mit positivem Testergebnis müssen unmittelbar ihre engen persönlichen Kontakte informieren. Die Beurteilung des Ansteckungsrisikos und die Anordnung beziehungsweise Aufhebung der Quarantäne obliegt in jedem individuellen Fall dem zuständigen Gesundheitsamt. Die Länge der Quarantäne kann also je nach Einzelfall variieren.
Folgendes sollte aber auf jeden Fall beachtet werden:
- Einzelunterbringung in einem gut belüftbaren Zimmer.
- Begrenzung der Kontakte zu anderen Menschen, insbesondere wenn sie einer Risikogruppe angehören. Dazu zählen vor allem Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, chronisch Kranke, Ältere und Schwangere.
- Mitbewohner und Familienangehörige sollen sich in der Regel in anderen Räumen aufhalten oder einen Mindestabstand von mindestens ein bis zwei Metern einhalten.
- Die Nutzung gemeinsamer Räume sollte auf ein Minimum begrenzt werden und möglichst zeitlich getrennt erfolgen. Diese Räume, vor allem Küche und Bad, müssen regelmäßig gereinigt und gut gelüftet werden.
- Regelmäßiges gründliches Händewaschen vor und nach der Zubereitung von Speisen, vor dem Essen, nach dem Toilettengang. Zum Trocknen am besten Einweg-Papiertücher verwenden.
- Bei Husten oder Niesen auf jeden Fall Mund und Nase mit Einweg-Taschentüchern oder gebeugtem Ellbogen abdecken - und bei Gesellschaft in eine andere Richtung niesen.
Ist man nach einer Infektion immun?
Studien haben gezeigt, dass Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus spezifische Antikörper entwickeln. Zwar können Antikörper mindestens sechs bis acht Monate nach Infektion nachgewiesen werden, jedoch nimmt die Menge der nachweisbaren Antikörper mit der Zeit wieder ab. Es ist noch nicht klar, zu welchem Grad die Antikörper-Menge mit einem Schutz vor einer Neuinfektion oder schweren Erkrankung zusammenhängen. Zuletzt zeigte sich, dass sich aufgrund der Anpassungs- und Mutationsfähigkeit des Coronavirus auch Menschen wieder infizieren können, die eine Erkrankung an Covid-19 bereits überstanden hatten.
Sind Kinder besonders gefährdet?
Nein, im Gegenteil. Sie erkranken bei einer Infektion mit dem Coronavirus eher selten ernsthaft. Auch als Überträger spielen sie offenbar eine eher untergeordnete Rolle. Trotzdem gilt im Präsenzbetrieb der Schulen eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Selbsttests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiterem Personal.
Was müssen Schwangere beachten?
Schwangere, deren SARS-CoV-2 Infektion im Krankenhaus festgestellt wurde, weisen vergleichsweise seltener Symptome wie Fieber, Atemnot und Muskelschmerzen auf. Die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf mit Aufnahme auf eine Intensivstation und für eine invasive Beatmung ist gering, jedoch im Vergleich höher als bei nicht-schwangeren Frauen im gebärfähigen Alter, Todesfälle sind selten.
Schwangere Frauen können bereits geimpft werden. Die Impfung von Frauen mit Kinderwunsch wird empfohlen, so die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Nach bisherigem Kenntnisstand sei mit der Verabreichung von Nicht-Lebendimpfstoffen während der Stillzeit kein erhöhtes Risiko für die Stillende oder den Säugling verbunden.
Was sollen Tierhalter tun, die in Quarantäne oder infiziert sind?
Am besten unterstützen geeignete Menschen außerhalb des Haushalts sie bei der Tierpflege, beispielsweise beim Gassigehen mit dem Hund. Wichtig: Ein Infektionsrisiko geht grundsätzlich nicht von dem Tier aus, sondern von den möglicherweise infizierten Besitzern. Bestätigt Infizierten rät das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) für Tiergesundheit, engen Kontakt zu Haustieren wie das Abschlecken des Gesichts zu vermeiden.
Für Tiere ohne Krankheitssymptome wird laut FLI keine Quarantäne empfohlen - beim Auftreten von Symptomen kann aber ein Test auf eine Infektion sinnvoll sein. Dafür sollte sich das zuständige Gesundheitsamt mit dem Veterinäramt in Verbindung setzen. "Es besteht kein Grund dafür, Haustiere vorsorglich in Tierheimen abzugeben. Sollte ein Haustier positiv auf SARS-CoV-2 getestet werden, stellt dies keinen Grund dar, das Tier einzuschläfern", so das FLI.
Können Haustiere sich infizieren?
Es gibt laut FLI bisher keine Hinweise darauf, dass bei uns übliche Nutztiere/lebensmittelliefernde Tiere eine Rolle bei der Verbreitung des Virus spielen oder als Infektionsquelle für den Menschen relevant sein könnten. Bisher hätten sich Hunde, Katzen, Kaninchen, Goldhamster und Frettchen als empfänglich für SARS-CoV-2 erwiesen - Meerschweinchen dagegen nicht. Trotzdem gebe es bisher keine Hinweise darauf, dass Haustiere wie Hunde oder Katzen eine Rolle bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 spielen.
Können Menschen sich bei Hunden oder Katzen anstecken?
Darauf gibt es keine Hinweise. Auch spielen Hunde und Katzen nach aktueller Lage keine Rolle bei der Verbreitung des Virus. Eine erste tierexperimentelle Studie aus China und die bisherigen Fälle wiesen auf eine geringe Empfänglichkeit von Hunden für SARS-CoV-2 hin, so das FLI.
Kommt das Coronavirus nicht ursprünglich von Tieren?
Nach FLI-Angaben deuten Untersuchungen zwar darauf hin, dass eng verwandte Viren bei bestimmten Fledermäusen vorkommen. Unklar ist demnach jedoch, ob das Virus direkt von Fledermäusen auf Menschen übertragen wurde oder ein tierischer Zwischenwirt eine Rolle bei der frühen Übertragung auf den Menschen spielte. Eine Studie ergab auch, dass Marderhunde Überträger sein könnten.
Wie funktioniert die Corona-Warn-App?
"Ein zentraler Bestandteil der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten. Die Corona-Warn-App kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten und die zentrale Arbeit der Gesundheitsämter beim Nachverfolgen der Kontakte unterstützen", so das RKI. Hier können Testergebnisse sowohl abgefragt als auch eingetragen werden, um andere zu warnen. Zudem kann man mittels eines QR-Codes bei Veranstaltungen einchecken oder selbst ein Treffen erstellen, was bei der Nachverfolgung der eigenen Kontakte unterstützt.
In der Corona-Warn-App kann außerdem das persönliche Risiko, in den vergangenen 14 Tagen mit einer infizierten Person zusammengetroffen zu sein, ermittelt werden. Voraussetzung ist natürlich, dass möglichst viele diese Funktion überhaupt nutzen und per Bluetooth bedienen. Wenn sich eine Person mit dem Virus infiziert hat, dies in ihrer App angibt, erhalten alle anderen, die sich in der Nähe aufgehalten haben, eine Nachricht.
Was sagt die Reproduktionszahl „R" eigentlich aus?
Die Reproduktionszahl – kurz R – beschreibt, wie viele Menschen ein Infizierter während seiner eigenen Erkrankung ansteckt. Sie ist damit eine wichtige Kenngröße, um die Dynamik einer Pandemie einzuschätzen. Liegt die Zahl dauerhaft über eins, breitet sich eine Krankheit in der Bevölkerung aus. Die Reproduktionszahl des RKI bildet aber stets "die Infektionsrate von vor etwa eineinhalb Wochen ab", betont RKI-Vizepräsident Lars Schaade.
Welche Zahlen neben "R" sind ebenfalls entscheidend?
Zum einen werden aktuelle Infektionszahlen beobachtet, die sogenannte Wocheninzidenz. Sie zeigt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage und wird pro 100.000 Einwohner angegeben. So lassen sich Kommunen leichter miteinander vergleichen.
Neu hinzugekommen ist die Hospitalisierungsinzidenz. Damit ist ein Schwellenwert gemeint, der über bestimmte Regeln in einem Bundesland entscheidet. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Liegt dieser Schwellenwert über 3, treten flächendeckende Zugangsbeschränkungen ein, nur Genesene und Geimpfte bekommen Zutritt (2G). Wird ein Wert von 6 überschritten, werden in bestimmten Einrichtungen Tests von Geimpften und Genesenen fällig (2G plus). Bei Eintreten eines Schwellenwertes von 9 können die Länder noch weitergehende Beschränkungen machen.
Wo gibt es aktuelle Informationen zum Coronavirus?
- Übersichtsseite des Robert-Koch-Instituts
- Aktuelle Risikobewertung des RKI
- FAQ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
- FAQ des Bundesgesundheitsministeriums
- Liveblog zum Coronavirus auf nw.de
Die Corona-Situation in Deutschland und OWL - Fallzahlen in Echtzeit
Die Lage in den Krankenhäusern
Links zum Thema
Themen-Spezial: Alle Informationen zur Corona-Lage in OWL und der Welt