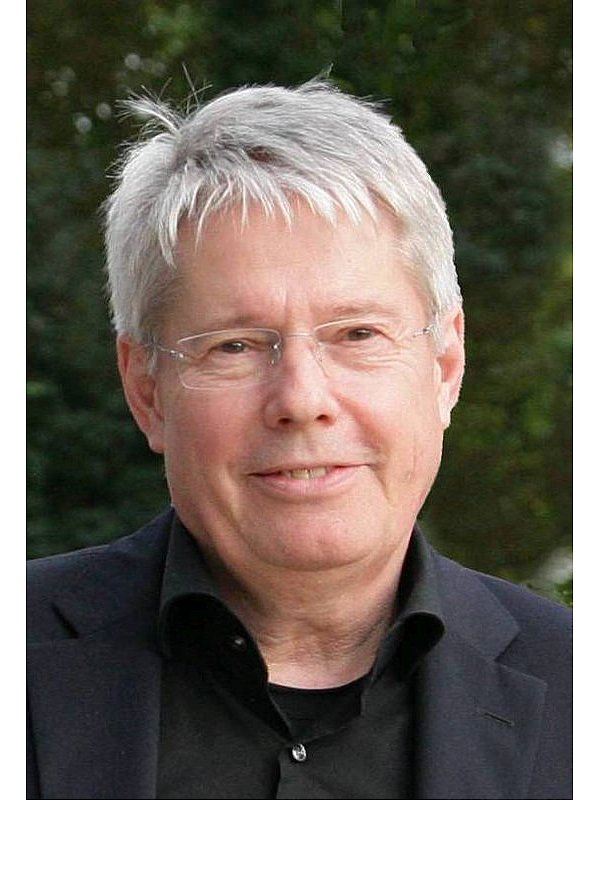Lügde. Die Ausmaße des Missbrauchsskandals von Lügde beschäftigen nicht nur die Justiz, die sich vorrangig um die Aufarbeitung der Taten kümmert. Leicht aus dem Fokus gerät angesichts gravierender Systemfehler bei Polizei und Jugendämtern die Perspektive der Opfer, denen nicht selten jahrelange Therapien bevorstehen, um das Erlebte zu verarbeiten. Bietet OWL dafür genug niedrigschwellige Angebote?
Wie ist die Versorgung aktuell?
OWL ist mit Psychotherapeuten überversorgt, sagt die Kassenärztliche Vereinigung (KVWL), die neben den Ärzten auch die Interessen der niedergelassenen Psychotherapeuten vertritt - zumindest nach dem mathematischen Schlüssel, den die von Bund und Land erstellte Bedarfsplanung vorsieht (siehe Infokasten). Hinzu kommen Praxen von Therapeuten, die ausschließlich Privatpatienten behandeln, da diese sich auch in kassenärztlich überversorgten Gebieten niederlassen dürfen.
Trotzdem müssen Therapiebedürftige laut Bundespsychotherapeutenkammer oft monatelang auf ein erstes Gespräch warten. In der Wartezeiten-Studie 2018 ist für NRW die Rede von im Schnitt fast sechs Wochen Warten auf einen ersten Termin in der Sprechstunde, tiefergehende Therapie ist hingegen erst nach fast sechs Monaten (23,1 Wochen) möglich. Akut zu behandelnde Patienten in Krisen oder mit Traumata - hier kommen unter Umständen die Opfer von Lügde und ihre Angehörigen ins Spiel - werden jedoch in der Regel schneller beraten, im Schnitt drei Wochen nach Anfrage.
Gerd Höhner, Präsident der Psychotherapeutenkammer NRW, will den Fall von Lügde nicht zum Anlass nehmen, um über Versorgungsprobleme zu klagen. "Es gibt Möglichkeiten, akute Versorgung schnell bereitzustellen. Einen Weg findet man immer." Man könne das Versorgungssystem nicht als Ganzes auf solche Extremsituationen ausrichten.
Insbesondere an den Wartezeiten und der Zahl der tatsächlich erbrachten Therapieleistungen lasse sich aber erkennen, dass der Bedarf an therapeutischer Begleitung die tatsächlichen Kapazitäten deutlich übersteigt. Das habe mit besserer Vermittlung durch Hausärzte, aber auch einer steigenden Bereitschaft zu tun, sich therapeutische Hilfe zu suchen.
Was bedeuten Wartezeiten für traumatisierte Opfer?
Generell lässt sich sagen: Es geht ihnen nicht in jedem Fall schlechter. Michael Böwer, Kinderschutzforscher an der Katholischen Hochschule NRW, erklärt, dass der Umgang mit Traumata sehr unterschiedlich ist. "Was man annehmen würde ist die Gleichung: Je graviender das Ereignis, desto schlimmer die Traumafolgen. Tatsächlich hat man festgestellt, dass sich die subjektiven Fähigkeiten eines Kindes, mit einer bestimmten Situation umzugehen, auf das Ausmaß des Traumas auswirken."

Dennoch hätten die ersten Gespräche mit Eltern der Opfer von Lügde gezeigt, dass viele der betroffenen Kinder "mit Depressionen, mit Angststörungen reagieren", sagt Böwer. "Sie bekommen Weinkrämpfe, ziehen sich zurück oder wollen nachts das Licht nicht mehr ausmachen." Wichtig sei deshalb, systemisch zu therapieren, also auch Familie und Umfeld einzubinden.
Und Böwer sagt auch: "Wenn wir Betroffene als Erwachsene fragen, was sie rückblickend in einer solchen Situation gebraucht hätten, dann ist die Antwort: Dass mir jemand zuhört und mir glaubt." Je weniger Opfer dieses Gefühl vermittelt bekämen, desto größer sei die Gefahr, "dass Traumafolgestörungen nicht angemessen behandelt werden können".
Dagmar Bothe, die für die Opferschützer vom Weißen Ring in Lippe 14 der bisher 41 identifizierten Opfer von Lügde unterstützt, erklärt: "Es gab durchaus Fälle, da haben diese Personen Unterstützung abgelehnt, sei es Rechtsberatung oder das Angebot der Vermittlung zu einem Therapeuten." Ob der Grund dann tatsächlich fehlender Bedarf oder Verdrängung ist, sei im Einzelfall schwer einzuschätzen, sagt Bothe.
Böwer kritisiert auch, dass Eltern von Behörden den Eindruck vermittelt bekommen hätten, eine Therapie vor Prozessbeginn sei nicht ratsam. "Natürlich müssen sie so schnell es geht akut betreut werden." Die Polizei hatte sich gegen den Vorwurf gewehrt, ein Verbot ausgesprochen zu haben. Eine ärztliche Beratungsstelle zur Stabilisierung der Opfer ist eingerichtet und wird auch genutzt, sagt Bothe. Und der Kreis Lippe betont: "Alle Opfer aus Lippe wurden angeschrieben und über Hilfs- und Beratungsangebote informiert."

Die Opferschutzbeauftragte für NRW, Elisabeth Auchter-Mainz, hatte bereits zwei offene Sprechstunden für die Opfer in einem Gemeindehaus durchgeführt. 12 Geschädigte kamen damals zurück nach Lügde. Mit einigen sei man immer noch in Kontakt, alle Ansprechpartner seien den Betroffenen bekannt, sagt sie auf Anfrage. "Die Stabilisierung ist das Wichtigste, die Kinder sind aufgewühlt, in ihrer Persönlichkeit beeinträchtigt." Auch sie verweist auf die unterschiedliche Resilienz jedes Betroffenen. "Ich will nicht ausschließen, dass sich in ein paar Monaten noch jemand bei uns meldet."
Warum ist der Bedarfsplan so "eng" gefasst?
Ein Teil der Antwort: Es geht ums Geld. Denn die KVen haben ein natürliches Interesse daran, die Leistungen ihrer Ärzte von den Krankenkassen bezahlt zu bekommen. Deren Budgets stiegen aber nicht, als 1999 das Berufsbild des Psychotherapeuten ins Versorgungssystem aufgenommen wurde.
Höhner beschreibt das als Konkurrenzsituation innerhalb des Versorgungsapparats, weil nun plötzlich psychotherapeutische Leistungen an mehr Stellen erbracht wurden, sich die Patienten breiter verteilten und damit auch ihr Geld und die Erstattungen der Krankenkassen.
Der aktuelle Bedarfsplan hat laut Bundespsychotherapeutenkammer aber noch ein anderes, fundamentales Problem: Er unterstellt, psychische Erkrankungen und Behandlungsbedarf seien auf dem Land seltener, deshalb brauche es dort weniger Therapeuten. Dies hätten aber Studien des Robert-Koch-Instituts widerlegt.
Hinzu kommt im Fall Lügde: Es braucht systemische Familientherapie für Kinder und ihre Eltern. "Dafür muss man als Therapeut spezialisiert ausgebildet sein", sagt Michael Böwer. "Da kann es mit der Versorgung auf dem Land schon mal schwierig werden." Die Zahl der Therapeuten pro 100.000 Einwohner ist in Lippe im Vergleich zum Rest von OWL mit am niedrigsten.
Wird sich die Situation verbessern?
Dazu gibt es unterschiedliche Ansichten. Laut Gerd Höhner, der für die Kammer auch im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) sitzt, wo über die Bedarfsplanung entschieden wird, ist geplant, bundesweit zusätzlich 780 neue Kassensitze für Psychotherapeuten auszuweisen. Dabei brauche es ihm zufolge eigentlich 2.500 neue Plätze.
Optimistischer stimmen Höhner die Pläne des Gesundheitsministeriums von Jens Spahn, die Ausbildung von Psychotherapeuten an die Universitäten zu verlegen. Über den Gesetzesentwurf wird im September vom Bundesrat entschieden. Der Gesetzgeber plant mit jährlich rund 2.500 Absolventen, die es bräuchte, um die aktuelle Versorgung aufrechtzuerhalten. "Die Nachfrage nach Studienplätzen ist aktuell deutlich größer", sagt Höhner. Er rechnet mit 3.000 Absolventen.
Michael Böwer ist da skeptischer. Von den aktuell zugelassenen Kinder- und Jugendtherapeuten haben laut Michael Böwer zwei Drittel ihre Qualifikation an einer Fachhochschule erworben. "Bisher konnte man sich auch mit sozialpädagogischer Ausbildung in der Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie fortbilden." Das ginge künftig nicht mehr. Für die Zugelassenen gelte zwar Bestandsschutz. "Aber wir müssen befürchten, dass die Versorgungsstruktur dann noch schlechter wird", sagt Böwer. "Nicht sofort, aber in ein paar Jahren."
INFORMATION
Versorgungsgrad in OWL
Stadt Bielefeld: 180,6 Prozent (1 Therapeut je 3.056 Einwohner)