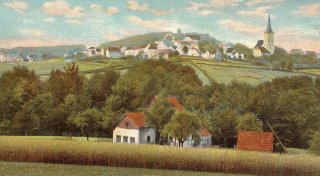Oerlinghausen. Johann Bracht muss wohl ein kluger und weitblickender, tüchtiger Mann gewesen sein. Denn der Landvogt Bracht, der Statthalter des lippischen Grafen, hat nicht nur das Bild des Dorfes durch rege Bautätigkeit verändert, sondern auch den verarmten Handwerkern Oerlinghausens nach dem unsäglichen 30-jährigen Krieg (1618 – 1648) ein regelrechtes Konjunkturprogramm zukommen lassen.
Das auffälligste Gebäude ließ er um 1660 errichten, ein stattliches quaderförmiges Haus aus Bruchstein und Fachwerk, wie es in Lippe kaum irgendwo zu finden war. Es lag an der heutigen Hauptstraße, dort wo der Brachtshof einmündet – nur einen guten Steinwurf von der Alexanderkirche entfernt. Für 3.000 Taler hatte er das Grundstück von seinem Vorgänger, dem verarmten Vogt Simon Barkhausen, erworben und nun das mächtige Bauwerk darauf gesetzt. „Schloss Bracht“ wurde das neue Amtsgebäude, in dem angesehene Landvogt mit seiner Familie nun lebte, in der Bevölkerung genannt. Rings um das Schloss entstanden bald darauf noch weitere Stallungen und Wirtschaftsgebäude.
Nur fünf Jahre später kam ein weiterer Neubau hinzu. Einige Meter oberhalb seines Schlosses an der Durchgangsstraße errichtete Johann Bracht eine repräsentative Gaststätte mit einer Fläche von etwa 250 Quadratmetern, den sogenannten Brachtschen Krug. In der Dorfschaft setzte insgesamt eine rege Bautätigkeit ein, beschreibt der lippische Chronist Ernst Fleischhack (gest. 1921) die Situation. So streckte Johann Bracht den Handwerkern Mittel vor, damit sie auch ihre eigenen Häuser renovieren oder neu bauen konnten. Dadurch entstanden auch an der Tönsbergstraße weitere Häuser.
Weil bei starken, wolkenbruchartigen Regengüssen das wertvolle Erdreich am Schloss häufig fortgespült wurde, sah sich Bracht genötigt, an der heutigen Holter Straße eine massive Mauer von 60 Zentimeter Stärke und bis zu fünf Metern Höhe bauen zu lassen. Noch heute ist die Mauer dort zu sehen, die man im Laufe der Jahrhunderte immer wieder reparierte. Woher Bracht das Geld hatte, ist weitgehend unbekannt. „Er muss in der letzten Phase des 30-jährigen Krieges an den Detmolder Hof gelangt sein und sich besondere Verdienste erworben haben“, heißt es in der Chronik. 1650 jedenfalls kam er erstmals nach Oerlinghausen und wurde bereits ein Jahr später vom Grafen Hermann Adolph zum Vogt ernannt. Wie eine Lizenz zum Gelddrucken aber wirkt sich eine andere Verfügung des Grafen aus: Johann Bracht erhielt das Privileg, Bier zu brauen sowie Wein und Branntwein nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb der Grafschaft Lippe zu vertreiben. Und nicht nur für ihn gelten die Privilegien, sondern auch für seinen Sohn, der als Nachfolger einmal das Amt des Landvogts übernehmen durfte. Johann Bracht legte auch den Grundstein für eine weitere positive Entwicklung des armen Bergdorfes, denn er unterstützte die Familien darin, sich Hauswebstühle zuzulegen. Durch diese Maßnahme begründete er einen wichtigen Erwerbszweig für die Oerlinghauser Bevölkerung, die Leinenweberei, die für fast zwei Jahrhunderte den Menschen ein wesentliches Einkommen sicherte. Und obendrein verpflichtet er Händler, die von den Hauswebern angefertigte Leinwand aufzukaufen. Das fortschrittliche, aufgeklärte Denken teilt er wohl mit seinem Freund, dem Pastor Johann Martheus. Den Beiden ist es wohl zu verdanken, dass die zu jener Zeit in Lemgo und anderen Orten tobenden Hexenverfolgungen und -prozesse nicht auf Oerlinghausen überzugreifen vermochten, vermutet der Chronist.
Der Graf zur Lippe wollte feiern, aber nicht zahlen
Im Jahre 1677 starb Johann Bracht, doch sein Sohn Hermann Adolf Bracht, der nun im Schloss die Amtsgeschäfte führte, war nicht minder begabt. Sein anfänglich gutes Verhältnis zum Grafen zeigte sich auch darin, dass dieser häufig in Oerlinghausen und in Brachts Schloss zu Gast war und sich üppig bewirten ließ – natürlich alles ohne Bezahlung. „Einmal hatte Bracht 16 Herrschaften und 26 Diener zu verpflegen“, heißt es. „Ein anderes Mal wurden bei einem gräflichen Besuch 64 Maß Wein getrunken.“ Auch die Einrichtung des Hauses verriet einen respektablen Wohlstand. „Brachts besaßen ein reichhaltiges Silbergeschirr, viele Betten und anderes Mobiliar“. Für seine zehn Kinder verpflichtete der Landvogt einen eigenen Hauslehrer. Doch weil er dem verschwenderischen Grafen Friedrich Adolph zur Lippe einmal seine Rechnung präsentierte und auf Bezahlung von offenen Forderungen drängte, drehte der Regent den Spieß um, ließ Hermann Adolf Bracht verhaften und ins Gefängnis werfen. Die Familie wurde nebst Kindern vertrieben und ein Günstling des Hofes erwarb das Oerlinghauser Schloss.
Als Bracht nach seiner Entlassung auf Rückgabe klagte und den Fall sogar bis zum Reichskammergericht in Wetzlar brachte, dauerte es trotzdem noch Jahre – bis nach dem Tod des Grafen im Jahre 1718 – dass Bracht endlich sein mittlerweile heruntergewirtschaftetes Eigentum zurückbekam. Kurz darauf starb er. Wegen der Erbteilung konnte sein Sohn die Oerlinghauser Besitztümer nicht mehr halten, und so wurden 1752 das Schloss und alle Gebäude und Grundstücke öffentlich versteigert. Sieben Personen ersteigerten Brachts Familieneigentum und teilten den Besitz – das Schloss, den Krug sowie weitere Gebäude – unter sich auf. Doch immer wieder wechselten in den folgenden Jahrhunderten die Besitzer. Das Ende des Oerlinghauser Schlosses wurde im Jahre 1901 eingeläutet, ein großer Brand vernichtete das gesamte Gebäude. Elf Familien hatten zum Schluss darin gewohnt.