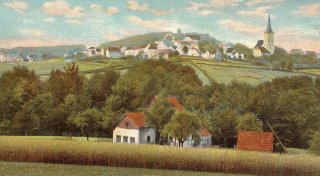Oerlinghausen. Was wäre die Oerlinghauser Alexanderkirche ohne ihre prächtige Orgel? Unzählige Kirchenbesucher hat ihr Klang begeistert, zahllose Gottesdienste hat sie begleitet. Von feierlichen Konfirmationen über Erntedankgottesdienste bis zu festlichen Weihnachtspredigten im übervollen Kirchenschiff. Bald 340 Jahre ist das riesige Instrument alt, das hoch über den Köpfen der Gottesdienstteilnehmer erklingt. Ihr Aussehen und ihr Stil erscheinen außergewöhnlich exklusiv für eine relativ kleine lippische Kirchengemeinde wie Oerlinghausen.

„Holländischer Bauernbarock“ nennt eine Schrift der evangelischen Gemeinde die Stilrichtung ihres schmuckvollen Äußeren mit einem farbenfrohen, facettenreichen Wappen und vielen Symbolen. Die Niederlande nämlich sind das Geburtsland der Stifterin der Orgel. „Gräfin Amalie, geborene Burggräfin zu Dohna, hat die kostbare Handarbeit 1688 gestiftet“, heißt es. Welcher Künstler ursprünglich die prachtvolle Orgel geschaffen hat, ist offenbar unbekannt. Die Holzarbeiten im Unterbau wurden von Bildhauer Hattenkerl aus Bielefeld ausgeführt.
Gräfin Amalie (1644-1700) gilt neben der berühmten Fürstin Pauline zur Lippe als eine der großen Persönlichkeiten im lippischen Herrscherhaus. Sie brachte ihrem Mann Graf Simon Henrich zur Lippe diverse Besitzungen mit in die Ehe – große Gebiete in den Niederlanden, die die kleine Grafschaft Lippe enorm aufwerteten.
Herrschaft war Männersache
Cornelia Müller-Hisje, die als Gästeführerin in Detmold arbeitet und als Kulturvermittlerin der lippischen Geschichte und Landschaften gilt, sprach im Oerlinghauser Heimatverein über bedeutende Frauen des lippischen Adels. „Herrschaft war Männersache, das hat uns bis auf wenige Ausnahmen stets die Geschichte gezeigt“, sagte sie. Im September 1666 heiratete Amalie ihren Simon Henrich zur Lippe (1649-1697), der im Oktober 1666 nach dem Tod seines Vaters als regierender Graf die Herrschaft in Lippe übernahm. Natürlich war die Ehe, wie üblich, politisch vorbereitet. Initiiert wurde das Bündnis von Friedrich Wilhelm von Brandenburg, dem „Großen Kurfürst“.

Simon Henrich und Amalie bildeten offenbar ein gutes Team. Sie herrschten als Ehe- und Arbeitspaar 31 Jahre in Lippe, bis zum Tod Simon Henrichs im Jahr 1697. In dieser Zeit übernahm Amalie typische landesmütterliche Aufgaben. So war sie die erste Repräsentantin der Grafschaft Lippe, vertrat Hof und Herrscherhaus nach außen hin. Sie empfing nicht nur Besucher, Familie und Gesandtschaften bei Hofe, sondern war auch für den reibungslosen Ablauf des höfischen Alltags verantwortlich. Sie agierte in enger Abstimmung mit Simon Henrich und fungierte als enge Vertraute und Beraterin ihres Mannes. Und zu den Pflichten einer „First Lady“ zählte stets karitatives Engagement.
Zudem betätigte sich Amalie wirtschaftlich sehr erfolgreich. Nachdem Simon Henrich ihr eine lippische Meierei übertrug, nahm Amalie die Verwaltung des Guts in die eigenen Hände und wirtschaftete viele Jahre bis zu ihrem Tod so erfolgreich, dass sie durch die Einkünfte aus der Meierei ein eigenständiges Einkommen besaß, das unabhängig von ihren höfischen Apanagen lief. Sie führte sogar die Rechnungsbücher eigenständig.
Zur höfischen Repräsentation gehörte aber auch der Aufbau herrschaftlicher Prunkbauten. Amalie und Simon Henrich leiteten ab 1680 den Bau des Jagdschlosses Lopshorn und einige ambitionierte Gartenbauprojekte in die Wege. Auch das Residenzschloss in Detmold wurde in ihrer Herrschaftszeit im Barockstil modernisiert.
Cornelia Müller-Hisje zitierte abschließend Graf Friedrich Adolf, den Sohn und Nachfolger, der in seinen Memoiren über seine Eltern schrieb: „Meine Mutter war eine absolute Herrscherin in Detmold, und alle vorkommenden Obliegenheiten fielen ihr unbeschränkt zu. Mein Vater hat sich in allem auf sie verlassen, da er nichts so sehr liebte als die Ruhe und die Jagd.“

Während Amalie und Simon Henrich das höfische Leben nach französischem Vorbild schätzten und dabei die Staatsfinanzen gehörig strapazierten, trat etwa ein Jahrhundert später eine ganz anders orientierte, lippische Herrscherin auf den Plan, Fürstin Pauline (1769 – 1820). Sie trug bereits den Fürstentitel, denn 1789 war Lippe von der Grafschaft zum Fürstentum aufgestiegen. „Im geschichtlichen Bewusstsein der lippischen Bevölkerung rangiert Paulines soziales Engagement an erster Stelle“, heißt es bei Wikipedia. Sie gründete die erste Kinderbewahranstalt in Deutschland, eine „Erwerbsschule für verwahrloste Kinder“, ein „freiwilliges Arbeitshaus für erwachsene Almosenempfänger“ und eine „Pflegeanstalt mit Krankenstube“.
Neben dem sozialen Verständnis besaß Pauline ein ausgeprägtes politisches Talent. Und sie konnte gut mit Napoleon. Lippe befand sich zu dieser Zeit zwischen den verfeindeten Mächten Frankreich, Preußen und Hessen und drohte im Verlauf der Konflikte von dem einen oder anderen Nachbarn okkupiert zu werden. Doch Pauline gelang es, die Unabhängigkeit des Fürstentums Lippe zu erhalten – es war ihr größter außenpolitischer Erfolg.