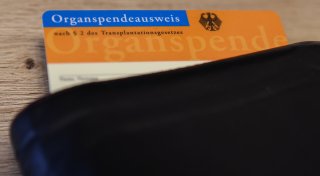Bielefeld/Berlin. Darf man hirntoten Patienten künftig Organe und Gewebe entfernen, wenn sie dem zu Lebzeiten nicht widersprochen haben? Diese Reform kann in Kraft treten, wenn der Bundestag nächste Woche für die Widerspruchslösung stimmt. Kurz vor der Entscheidung melden sich die Kritiker zu Wort.
„Das ist ethisch bedenklich", findet Ralf Stoecker, Professor für Praktische Philosophie an der Universität Bielefeld. Er bewertet die aktuelle Entscheidungslösung als gut: Nur wer seine Einwilligung gegeben hat oder bei dem klar ist, dass die Spende in seinem Sinne ist, kann auch Organspender werden.
Rund 10.000 Menschen warten auf ein Organ

Hintergrund der Neuabstimmung ist, „dass Deutschland hinsichtlich der Organspendezahlen am Ende der europäischen Skala steht", erklärt Friedhelm Bach, Transplantationsbeauftragter Arzt in NRW. Dem gegenüber stehen hingegen 10.000 Menschen auf der Warteliste für ein Organ. Bach sieht in der Widerspruchslösung „eine Chance, die Leute aufzurütteln und zum Nachdenken anzuregen."

Klaus Kobert, Klinischer Ethiker am Evangelischen Klinikum Bethel, hatte als Oberarzt auf der Intensivstation unmittelbar mit dem Thema zu tun. Er glaubt zwar nicht, dass die Widerspruchslösung viel bewirken wird, kann die Gründe ihrer Einführung aber nachvollziehen.
Beim Hirntod gibt es kein Zurück ins Leben
„Das Thema betrifft meist Menschen, die eine schwere Hirnverletzung oder Hirnblutungen haben", erklärt Kobert. Verlaufe die Krankheit schlecht und in Richtung Hirntod, komme man irgendwann an den Punkt, an dem man sich entscheiden müsse: Wechselt man von einer intensivmedizinischen Behandlung auf eine palliative oder hält man den Patienten bis zum Hirntod am Leben, um ihm die Organe entnehmen zu können? Ein Zurück in ein selbstbestimmtes Leben sei ab diesem Zeitpunkt ausgeschlossen. „Wie bei einem Sprung ins Wasser gibt es nur eine Richtung, der Körper ist nur noch nicht ganz abgetaucht", so Kobert. Und beim Hirntod schließlich gebe es keinen Irrtum, dass der Mensch tot ist.

„Die Entscheidung, ob eine Organspende vorgenommen werden soll, müssen die Angehörigen treffen, wenn der Patient sich im Vorfeld nicht dazu geäußert hat", erklärt Kobert. „Viele sind in einer solchen Ausnahmesituation damit überfordert. Da merkt man, dass das für die Betroffenen sehr belastend und quälend ist."
70 Prozent der Angehörigen entscheiden sich gegen Organspende
Rund 70 Prozent entschieden sich dann gegen eine Organspende – „aus Angst, die falsche Entscheidung zu treffen, weil in den Familien oft nicht über das Thema gesprochen wurde", sagt Mediziner Bach.
Dieser Zwangslage könnte entgegengewirkt werden, müsste sich künftig jeder Bürger mit dem Thema auseinandersetzen. Es würde aber auch einen „Paradigmenwechsel einleiten", sagt Kobert. Der Deutsche Ethikrat sowie Stoecker sehen dabei ein wichtiges Gegenargument. „Die Organspende wird so zu einer Selbstverständlichkeit erklärt", sagt Stoecker. „Der Charakter einer Spende oder Gabe geht dabei verloren", findet auch Kobert.
Schiefes Licht auf Nicht-Spender
Es sei zudem ein großer Unterschied, ob man die Wahl zur Einwilligung habe oder das Recht zu verweigern, sagt Stoecker. Durch die Widerspruchslösung verändert sich laut Stoecker der Blickwinkel: Der eigene Körper gehe nun nicht mehr nur einen selbst etwas an, sondern werde etwas, mit dem etwas gemacht werden dürfe – es sei denn, man protestierte. Aber derjenige, der nicht spendet, gerate durch die Widerspruchslösung in ein „schiefes Licht".
Dabei könne es „gute Gründe" geben, dass ein Mensch seine Organe nicht spenden möchte. „Und das hat die Gesellschaft zu respektieren", erklärt Stoecker. Manch einer wolle als Ganzes sterben, unangetastet. Anderen sei es wichtig, im Beisein der Angehörigen die letzten Atemzüge zu tun. „Eine Sterbesituation ist etwas ganz Persönliches und Eigenes", sagt Stoecker.
Friedhelm Bach und Klaus Kobert finden wichtig, dass die Gesellschaft weiter aufgeklärt wird und dass man sich entscheidet – für die eine oder andere Möglichkeit. „Und dass die Familien über den Willen Bescheid wissen", so Kobert.