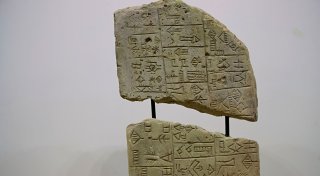Bielefeld. „Kaum ein anderer Dichter hat die deutsche Sprache so bereichert wie Hölderlin, kaum einer fordert bis heute die Literatur und die Künste so heraus", würdigt das Literaturarchiv Marbach den am 20. März vor 250 Jahren in Lauffen am Neckar geborenen Dichter Friedrich Hölderlin. Der Bielefelder Literaturwissenschaftler Wolfgang Braungart nennt Hölderlin, der 1843 umnachtet im später so genannten Hölderlinturm in Tübingen starb, schlichtweg den „größten deutschen Lyriker". Im Gespräch mit dieser Zeitung nähert sich der 64-jährige dem Poeten und Menschen an.
HÖLDERLIN, DER SOHN
Hölderlins Familie, sein Vater starb früh, gehörte laut Braungart „zur schwäbischen Ehrbarkeit, wie es damals hieß". Die Mutter habe wieder geheiratet und gehofft, dass ihr Sohn – nach seiner Ausbildung an der Latein- und Klosterschule sowie im Evangelischen Stift von Tübingen – den Beruf des Pfarrers ergreifen würde. Doch Hölderlin habe diesen für die bürgerliche, schwäbische Elite vorgezeichneten Lebensweg nicht mehr beschreiten können, sondern sich früh der Poesie verschrieben. „Er wollte Dichter sein, nicht Pfarrer", betont Braungart und fügt an: „Seine Mutter, die ihn aus seinem Erbe und einem Gratial der Landesregierung finanziell unterstützt hat, hat seine Entscheidung nie wirklich verstanden. Insofern war er als Sohn eine Enttäuschung für sie."
. . ., DER DICHTER
Ohne zu zögern, sagt Braungart: „Er ist für mich schlichtweg der größte deutsche Lyriker." Sein lyrisches Werk umfasse eine unglaublich große, ja, einzigartige Spannbreite. Er schreibe einerseits faszinierend lakonische Verse, die manchmal fast an japanische Haikus erinnern mögen, die einfach das erfassen, was ist; dann hebt er zu großen Oden, Hymen und Elegien an und lotet die Sprache bis an die Grenze des Sagbaren aus, um schwierigste Gedanken zu Papier zu bringen. Das sei selbst bei Goethe und Schiller so nicht zu finden. Braungart fasziniert zudem: „Hölderlins Werk ist in höchstem Maße sinnlich."
. . ., DER ROMANCIER
Weniger angezogen ist Braungart, der seit 1996 an der Uni Bielefeld lehrt und forscht, hingegen vom Romanautor Hölderlin. Dessen einziger Roman, der Briefroman „Hyperion", bleibe hinter seinem lyrischen Werk zurück, obwohl er auch starke poetische Passagen aufweise. Braungart kritisiert, „dass er mit seinem griechischen Freiheitshelden Hyperion einen zutiefst narzisstischen Charakter entworfen hat, der in Schwarz-Weiß- Schemata denkt, blut- und erfahrungsarm gezeichnet wurde und als Figur überhaupt arg konstruiert wirkt".
. . ., DER FREUND
Die wohl bedeutendsten Freundschaften in seinem Leben hat Hölderlin mit dem jüngeren Schelling und dem ebenfalls 1770 geborenen Hegel im Tübinger Stift geschlossen. Braungart: „Sie waren drei ganz unterschiedliche Charaktere, die aber in ihrem Denken wiederum ganz nah beieinander waren." Von Kants Philosophie ausgehend, mischten sie sich selbst in das Denken ihrer Zeit ein, sie spürten, dass im Lande politisch, philosophisch und auch poetisch etwas in Bewegung geriet, und wurden mit ihren Schriften später selbst zu Bewegern. Braungart: „Sie ließen gemeinsam, begeistert von der Französischen Revolution, ihren freien, rebellischen Gedanken ihren Lauf. Freunde blieben sie über die Zeit im Stift hinaus."
. . ., DER LIEBENDE
„Hölderlin war letztendlich ein unglücklich Liebender", sagt Braungart und verweist auf dessen tragische Beziehung zu Susette Gontard. Die beiden hatten sich 1796, nachdem Hölderlin eine Hauslehrerstelle in Frankfurt beim Bankier Jakob Friedrich Gontard angetreten hatte, ineinander verliebt. „Eine Liebe, die beide nicht leben konnten, denn er gehörte als Hauslehrer zum Personal, und sie war eine verheiratete Frau mit vier Kindern", betont Braungart. Bereits 1798 habe Hölderlin die Stelle wieder aufgeben müssen, weil ihr Ehemann Wind von der Beziehung bekommen habe. Bis 1800 hätten sich die beiden allerdings noch heimlich Briefe geschrieben und wohl auch noch gesehen, so Braungart. „Und ihre schönste und vielleicht unbeschwerteste Zeit hatten sie in in Bad Driburg, wohin sie – ohne Susettes Ehemann – über Kassel vor den Französischen Revolutionstruppen 1796 geflohen waren", sagt Braungart. Was genau sie in den paar Wochen in Bad Driburg erlebt hätten, sei aber unklar.
Literarisch verewigt hat Hölderlin seine große Liebe Susette schließlich als Diotima in einigen Gedichten und in seinem Roman „Hyperion", in dem er ihr ein literarisches Denkmal gesetzt hat. „Doch die Diotima in seinen Werken ist nie eins zu eins Susette, sondern allenfalls ihre literarische Überhöhung", warnt Braungart vor direkten Rückschlüssen von Diotima auf die geliebte Susette. Das „Fragment von Hyperion", die Vorstufe zum späteren Roman, war auch schon vor der Frankfurter Zeit erschienen.
. . ., DER DEUTSCHE
Braungart ist überzeugt, dass er sie nicht wirklich gehasst habe, obwohl er die Deutschen durch Hyperion in der berühmten Scheltrede als „Barbaren von Alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden, tiefunfähig jedes göttlichen Gefühls" beschimpfen ließ. Er habe mit dieser Rede vielmehr die Entfremdung des Menschen von sich selbst anprangern wollen, als nur die Deutschen zu schelten. „Es ging ihm darum, nicht aus dem Blick zu verlieren, dass der Mensch ein sinnliches Wesen mit Gefühlen und Verstand ist, ein ganzer Mensch eben."
Volk und Nation seien zu dieser Zeit noch utopische Kategorien im in lauter Fürstentümer und Staaten zersplitterten Deutschland gewesen. „Wenn Hölderlin sich also begeistert vom Nationalstaat, vom deutschen Volk, vom ,Tod fürs Vaterland‘ (ein Gedichttitel) zeigt, dann als revolutionäre Idee und nicht, wie die Nationalsozialisten später glauben machen wollten, als einer der ihrigen." Von ihnen sei sein Werk klar missbraucht worden. „Er war kein Deutschland überhöhender Nationalist."
. . ., DER REVOLUTIONÄR
„Die französische Revolution mit ihren Versprechen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit hat er enthusiastisch begrüßt", betont Braungart. Später sei er über ihre Auswüchse und vor allem die Terrorherrschaft der Jakobiner sehr erschrocken gewesen. Braungart: „Den Idealen der Französischen Revolution blieb er dennoch grundsätzlich treu."
. . ., DER UMNACHTETE
Von 1807 bis zu seinem Tod im Jahr 1843 lebte Hölderlin in Tübingen im Turm von Schreinermeister Ernst Friedrich Zimmer. „Was genau mit ihm passiert war, dass er sich so sehr in sich zurückzog, nachdem er von einer Reise nach Bordeaux völlig erschöpft zurückgekehrt war, weiß niemand wirklich", sagt Braungart. Heute gehe die Forschung davon aus, dass es tatsächlich eine Geisteskrankheit war, die ihn zunächst in die Klinik von Professor Autenrieth und dann in den Turm führte, in dem sich die Schreinermeisterfamilie um ihn kümmerte. „Seine späte Dichtung, die im Turm entstand, zeichnet ein starkes Gespür für Form und Rhythmus aus. Er findet hier neue, sehr eindringliche Bilder in einer neuen, kargen, auch formelhaft wirkenden poetischen Sprache, die dem Unartikulierbaren, das sich in ihm selbst befindet, vielleicht poetisch-rituelle Sicherheit geben soll."
. . ., DER TOTE
„Er ist nie wirklich verstummt nach seinem Tod im Jahr 1843", sagt Braungart. Es habe immer wieder neue Rezeptionswellen seiner Arbeiten gegeben, die für die Lebendigkeit seines Werks sprechen. „Ich kann nur dazu ermutigen, Hölderlin zu lesen. Wer ihn entdecken möchte, sollte seine Ode ,Die Liebe‘ oder seine Elegie ,Der Gang aufs Land‘ lesen, beides vergleichsweise gut zugängliche Gedichte. Eine großartige Welt wird sich auftun, auch mit ,Andenken‘ oder ,Patmos‘, ähnlich wie beim Hören Beethovens."