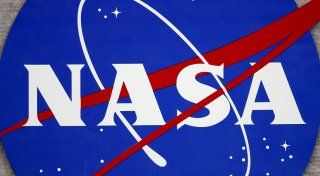Bielefeld. Spätestens seit den Atomkatastrophen von Tschernobyl (1986) und Fukushima (2011) gelten Kernkraftwerke weithin als Umweltfrevel. Nun aber macht eine neue Atomtechnologie Schlagzeilen, die einen Ausweg aus der Klimakrise verheißt - mit dem gleichzeitigen Versprechen von maximaler Sicherheit. Small Modular Reactors (SMR) - kleine, in Modulen gefertigte Reaktoren also - sollen die Energieprobleme der Welt sauber, kostengünstig und risikolos lösen können, behaupten die Verfechter.
Unter ihnen finden sich so prominente Namen will Bill Gates, Joe Biden, Boris Johnson oder Wladimir Putin. Die Idee dahinter: Statt wie bisher gigantische Anlagen zu bauen, die - wie Beispielsweise das Kraftwerk Grohnde - 1.400 Megawatt Strom liefern, könnte es bald in Spezialfabriken gefertigte Mini-Reaktoren von der Stange geben. Sie hätten lediglich eine Leistung von 50 bis maximal 300 Megawatt, wären dafür aber schnell und vergleichsweise billig aufzustellen. Das Mini-AKW für den Stadtrand gewissermaßen. Für Kritiker ein Horrorszenario.
Schneller, billiger, sicherer
Die Befürworter haben allerdings viele Argumente auf ihrer Seite: Ein konventionelles AKW zu bauen, dauert nicht selten Jahrzehnte. Es verschlingt Milliarden. Und es bringt im Falle eines Unglücks riesige Landstriche in Gefahr. Die SMR-Technologie dagegen wäre, einmal etabliert, durch Serienfertigung günstig und schneller zu installieren. "Anstatt im Lauf von – sagen wir – zehn Jahren ein großes Kernkraftwerk bei Anfangsinvestitionen von zehn Milliarden Euro zu errichten, setzt man viele kleinere, in einer Fabrik gefertigte Module ein. Man installiert sie, bringt sie ans Netz und verdient schon einmal Geld, bis man – je nach Bedarf – das nächste Modul hinzufügt", erläuterte William Magwood, Generaldirektor der Nuklear-Agentur der OECD im Deutschlandfunk das Konzept.

Ein Kraftwerks-Unglück ließe sich zudem leichter einhegen: Die Evakuierungszone müsste kaum über das Werksgelände hinausgehen, heißt es beispielsweise in einem Papier der US-Atomaufsicht NRC. Die Kernschmelze wäre auch technologisch leichter zu beherrschen, weil sich die Module schon wegen ihrer geringeren Größe leichter kühlen ließen.
Hauptargument: Klimaschutz
Vor allem aber sei die Energiegewinnung mittels Kernkraft klimaneutral. Dieses Argument pro Atomkraft ist nicht neu, wird aber wiederbelebt, seit die Klima-Krise stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt ist. Microsoft-Gründer Bill Gates, der mit seinem Unternehmen Terra Power in die Produktion solcher Mini-Meiler investiert, bewirbt die Technologie in seinem neuen Buch "Wie wir die Klimakatastrophe verhindern": Erneuerbare Energiequellen wie Solarstrom und Windkraft könnten nicht dauerhaft und gleichmäßig die Versorgung sicherstellen, in die entstehenden Lücken könnten die kleinen, flexibel zuschaltbaren Kraftwerke perfekt integriert werden.
Nur: Stimmen die Argumente auch? Bei Kosten und Schnelligkeit jedenfalls bleiben die SMR den Beleg ihrer Überlegenheit bislang schuldig. Bisher verschlingen sie vor allem große Summen. Ob USA, China, Russland oder Kanada: Milliarden Dollar an - zu nicht unerheblichen Teilen öffentlichen - Geldern werden derzeit in unterschiedliche SMR-Projekte gepumpt. Erst ein SMR ist schon am Start: Das schwimmende russische AKW Akademik Lomonossow, das seit einigen Monaten die Stadt Pewek in Sibirien mit Strom versorgt. Eines der am weitesten entwickelten Projekte, NuScale, ist im US-Bundesstaat Utah angesiedelt: Hier soll ein Komplex aus bis zu zwöf Mini-Reaktoren entstehen. Auch die US-Regierung unter Präsident Joe Biden, der seine Klimaschutz-Vorstellungen eng mit Kernkraft verknüpft, fördert das Projekt. Zwar soll ein Prototyp in naher Zukunft präsentiert werden, bis aber die Serienfertigung tatsächlich möglich ist, werden Jahre vergehen. In Großbritannien verspricht Rolls-Royce bis zu 40.000 neue Jobs mit seinem - staatlich geförderten - SMR-Programm, das 16 SMR vorsieht.
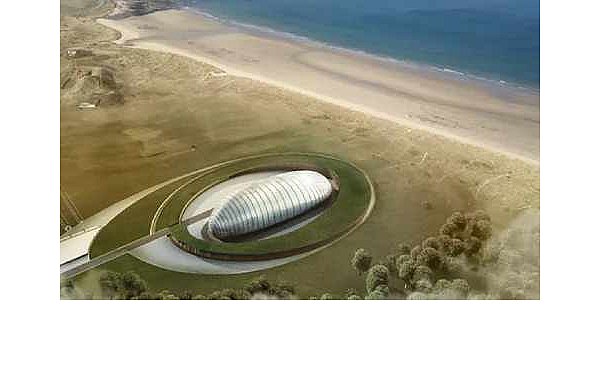
Krtitiker: "Völlig unrealistisch"
Christoph Pistner, Nuklearexperte beim Darmstädter Öko-Instutut, rechnet vor: Heute stamme zehn Prozent des Stroms aus weltweit etwa 400 Atomkraftwerken. Wenn Atomkraft überhaupt einen Beitrag leisten solle zur angestrebten Klimaneutralität 2050, müssten bis dahin mehrere Tausend SMR-Anlagen in Betrieb sein, nur um diese heutigen AKW zu ersetzen. Würde der Atomkraft ein noch größerer Klima-Beitrag zugeschrieben, "bräuchten wir Zehntausende solcher Anlagen - das ist völlig unrealistisch".
Auch hinter die Behauptung, die Serienfertigung werde die SMR-Technologie billig machen, setzt Pistner ein Fragezeichen: "Das Versprechen der Kernindustrie, günstigen Strom zu liefern, ist in der Geschichte nie gehalten worden." Angesichts steigender Kosten verabschiedeten sich schon heute immer mehr Städte von ihrem Engagement bei NusCale, berichten Fachdienste. Um die Klimawende zu beschleunigen, scheint das Konzept jedenfalls wenig zu taugen. Atomenergie rentiere sich einfach nicht, sagt auch Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium - gerade angesichts der Tatsache, dass erneuerbare Energien immer günstiger würden.
Alles andere als CO2-neutral
Vor allem aber sei sie kein Beitrag zum Klimaschutz. Diejenigen, die sich nach ihr zurücksehnten oder gar neue Reaktortypen wie den SMR anpriesen, nennt Flasbarth „Realitätsverweigerer". Das sieht auch der Physiker Pistner so. Zwar seien Kohle und Gas in Sachen C02-Produktion noch weit schlimmer. Aber wer Atomkraft als "saubere" Energie bewerbe, unterschlage regelmäßig die "Versorgungskette". Uranerz muss abgebaut und angereichert werden, das Kraftwerk selbst errichtet werden, Transport, Müllentsorgung und nicht zuletzt der aufwendige Rückbau: All das gehöre mit in die Klimabilanz.
Ein zentrales Argument Pistners aber ist: Wir brauchen die Atomkraft gar nicht für die Energiewende. Es stimme zwar: Sonne und Wind lieferten nicht immer gleichmäßig viel Strom. Das Problem sei aber viel besser ohne die gefährliche Kernenergie lösbar: Mit Hilfe ausreichend großer Stromnetze, in denen Strommengen hin und her geschickt werden; mit Hilfe neuer Speichertechnologien, die sich zurzeit enorm schnell weiterentwickeln; und mit Hilfe beispielsweise der Wasserstofftechnologie, bei der grün erzeugter Strom Wasser chemisch aufspaltet und die Energie so speichert. All diese Methoden führten dazu, dass man das herkömmliche Konzept der "Grundlastkraftwerke" bald nicht mehr brauche, um die Energieversorgung sicherzustellen.
Dazu kommt: Auch bei neuen Reaktortypen ist die Atommüll-Entsorgung letztlich ungeklärt. Und die beschäftigt, das zeigt der Fall Deutschland, auch nachfolgende Generationen über Jahrzehnte.