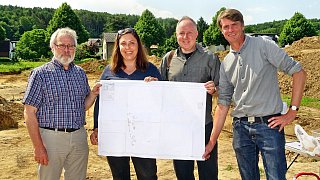Lübbecke. Umweltzerstörung – ein modernes Phänomen? Von wegen! Auch vor rund 2.000 Jahren sind schon ganze Wälder gerodet worden. Mit schlimmen Folgen, wie die Firma „ArchaeoFirm" und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in Gehlenbeck herausgefunden haben.
Dass früher alles besser war, ist ein gerne gepflegtes Vorurteil. Damals seien die Menschen naturverbunden gewesen und hätten nur das genommen, was sie zum Leben brauchten. Was für die frühen Jäger bis zu einem bestimmten Punkt gestimmt haben mag, gilt schon nicht mehr für die Ackerbauern mit ihrer Landwirtschaft.

Wie stark die Siedler in die Natur eingegriffen haben, zeigt eine Ausgrabung an der Bleichstraße in Gehlenbeck, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Kooperation mit „ArchaeoFirm" in Gehlenbeck durchführen lässt.
50 Zentimeter dicke Schlammschicht markiert Umweltfrevel
Ein Laie würde die rund 50 Zentimeter dicke Schlammschicht wohl kaum erkennen. Grau ist sie und ein Indiz für Umweltzerstörung, wie Sven Spiong, Leiter der Bielefelder Außenstelle der LWL-Archäologie für Westfalen, ausführt. Entstanden ist die Schwemmschicht vor über 2.000 Jahren, als keltisch geprägte Siedler den Boden beackerten. Damals seien in großen Umfang Bäume gefällt worden, erläutert Spiong das Problem. Wenn es dann stark regnete fand die Erde keinen Halt auf dem undurchlässigen Lehm. Der fruchtbare Boden rutschte den Hang herunter und ging verloren.
Ähnliche Schichten hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe auch schon in Porta Westfalica-Barkhausen nachweisen können. Dort seien die Schichten teilweise 90 Zentimeter mächtig, berichtet Spiong. Der Eingriff des Meschen in die Natur „hat aller Wahrscheinlichkeit nach große Ernteausfälle nach sich gezogen."
Auf der anderen Seite kommt der Hangrutsch den Archäologen durchaus zupass. Ohne die Schwemmschicht wären die Spuren des Hofes nicht so gut erhalten, sagt Hans-Otto Pollmann, Wissenschaftlicher Referent der LWL-Außenstelle Bielefeld. „Für uns war das ein echter Glücksfall."
"Für uns war das ein echter Glücksfall"
Eine genaue zeitliche Einordnung wird erst durch die Scherben möglich. „Anhand der Scherben können wir genau sagen, in welche Zeit das fällt", erläutert Spiong. Die gekerbten Ränder und die Fingerkuppeneindrücke würden eindeutig auf das zweite Jahrhundert vor Christus hindeuten.

Zusätzlich stießen die Archäologen auf eine runde Bronzescheibe, die möglicherweise als Teil des Zaumzeugs eines Pferdes gedient hat. „Auf Ebay würde es dafür nur ein paar Euro geben – für Archäologen sind die Funde unschätzbar wertvoll." Es müsse eben nicht immer Silber oder Gold sein, findet auch Christiane Kunde („ArchaeoFirm"). „Wir Archäologen sind mit spannenden Funden zufrieden."
Der Hof selbst bestand aus einem großen Wohnhaus und zwei, in den Boden eingelassenen Nebengebäuden. Seine Lebensdauer schätzen die Archäologen auf etwa 50 bis 100 Jahre. Man folgere das aus der Tatsache, dass das Holz nie ausgetauscht worden ist, „obwohl es nicht witterungsbeständig ist".
"Gleich beim ersten Mal erfolgreich"
Auf die Verfärbungen in der Erde (Reste vom Pfostenholz) stießen die Wissenschaftler vor zwei Wochen schon relativ schnell nach einem Suchschnitt. Man sei „gleich beim ersten Mal erfolgreich" gewesen, machte Christiane Kunze von „ArchaeoFirm deutlich. Die Arbeiten sollen in spätestens einem Monat abgeschlossen sein. Danach kann es in dem Neubaugebiet an der Bleichstraße losgehen.
Für die Archäologen sind die Funde jedenfalls sehr wichtig. Zum einen, weil erstmals eine Hofstelle des 2. und 3. Jahrhunderts vor Christus wissenschaftlich untersucht werden kann und zum anderen, weil die Ausgrabung einen „Lückenschluss" bildet.
„Diese Grabung ist für die archäologische Erforschung des Raums zwischen Wiehengebirge und Großem Torfmoor von besonderer Bedeutung", erläutert Spiong. Der schmale und höchst fruchtbare Streifen unter dem Gebirgskamm sei schon lange ein sogenannter „Verdachtsfall" für die Archäologen gewesen.