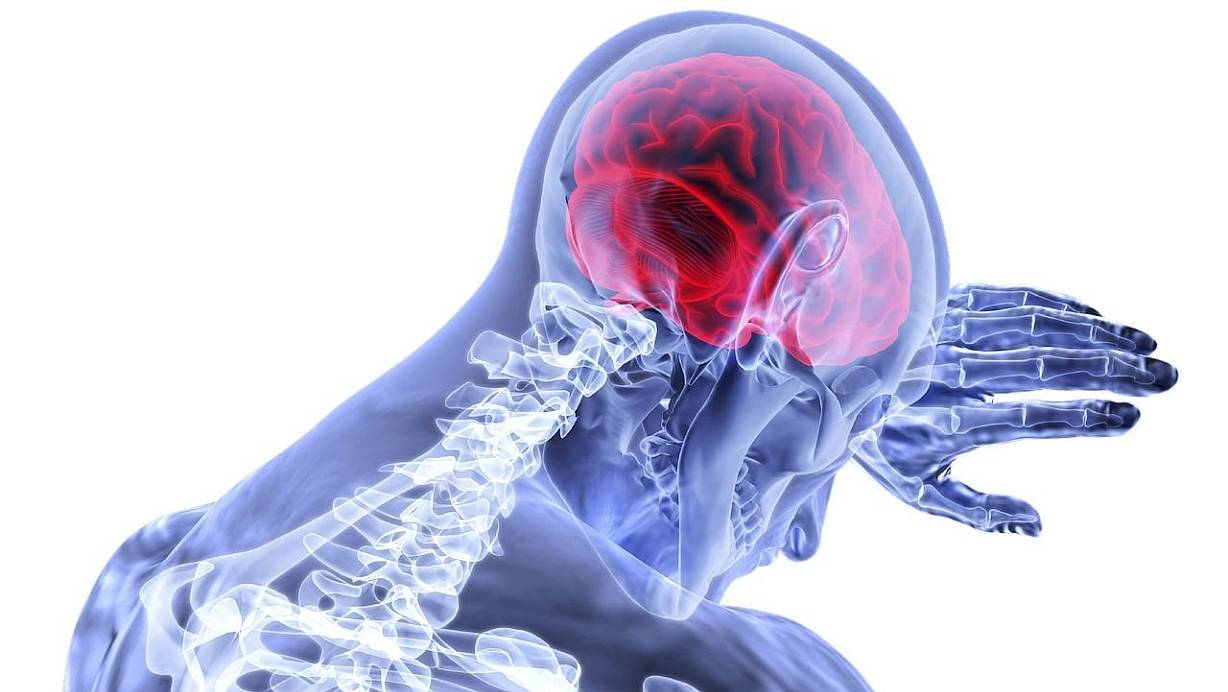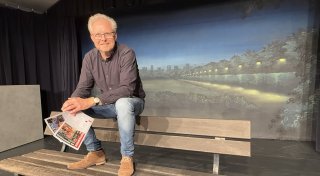Der Schlaganfall ist eine Volkskrankheit. Es trifft insbesondere die Altersgruppe der über 60-Jährigen. Aber auch jüngere Menschen können einen Schlaganfall erleiden. „Die Zahl in der Altersgruppe zwischen 18 und 55 Jahren steigt", berichtet Wolf-Rüdiger Schäbitz, Chefarzt der Klinik für Neurologie im Evangelischen Klinikum Bethel (EvKB). Jährlich sind etwa 15 Millionen Menschen weltweit davon betroffen. Fünf Millionen davon sterben an den Folgen. Etwa zwei Drittel sind danach pflegebedürftig. Besseres Wissen über die Symptome eines Schlaganfalls und ein schnelles Handeln kann Schlimmeres verhindern.
Durchblutungsstörung im Gehirn
Etwa 85 Prozent aller Schlaganfälle lassen sich auf den Verschluss eines Hirngefäßes aufgrund einer Arteriosklerose zurückführen - man spricht von einem Hirninfarkt oder „ischämischen Schlaganfall". Dabei findet eine plötzlich auftretende Durchblutungsstörung im Gehirn statt. Die Unterversorgung an Blut und damit auch an Sauerstoff und Nährstoffen führt schließlich zu neurologischen Ausfällen, wie einer halbseitigen Lähmung, Gefühls- oder Sprech- und Sprachstörungen. Nur etwa 20 Prozent der Schlaganfall-Fälle werden durch eine Hirnblutung (hämorrhagischer Hirninfarkt) verursacht.
Schlaganfall frühzeitig erkennen
Wie das Wort „Schlaganfall" bereits verrät, treten bei Betroffenen schlagartig, wie aus dem Nichts, mehr oder weniger deutliche neurologische Ausfälle auf. Anders als beim Herzinfarkt empfinden die Personen dabei allerdings oft keine Schmerzen. Das birgt die Gefahr, den Vorfall nicht ernst zu nehmen und zu zögern. Ein Fehler mit fatalen Konsequenzen! Auch ein zunächst leichter Schlaganfall kann sich zu einem schweren Schlaganfall ausweiten, wenn nicht reagiert wird.
FAST-Test durchführen
Wer schon beim leisesten Verdacht schnell handelt, verbessert die Chancen auf ein Weiterleben des Betroffenen mit möglichst wenigen, im besten Fall mit keinen Spätfolgen. Es gilt: „Time ist brain" (Zeit ist Hirn). Daher sollte der Verdacht auf einen Schlaganfall unverzüglich mit Hilfe des FAST-Tests - Face (Gesicht), Arms (Arme), Speech (Sprache) und Time (Zeit) – überprüft werden. „Der FAST-Test ist der verbreitetste Test weltweit, den Laien innerhalb weniger Sekunden durchführen können, um so die Anzeichen eines Schlaganfalls zu überprüfen", sagt Wolf-Rüdiger Schäbitz:
1. Gesicht: Bitten Sie die Person zu lächeln. Hängt ein Mundwinkel herab, deutet das auf eine Halbseitenlähmung hin.
2. Arme: Bitten Sie die Person, die Arme nach vorne zu strecken und die Handflächen nach oben zu drehen. Bei einer Lähmunge können nicht beide Arme gehoben werden, ein Arm sinkt oder dreht sich.
3. Sprache: Lassen Sie die Person einen einfachen Satz nachsprechen. Ist sie dazu nicht in der Lage oder klingt die Stimme verwaschen, liegt vermutlich eine Sprachstörung vor.
4. Zeit: Wenn entsprechende Symptome auftreten, wählen Sie IMMER die Notrufnummer 112 und nennen Sie die beobachteten Symptome. „Es gibt eine standardisierte Abfrage, mithilfe der neurologische Ausfälle direkt von der Rettungsleitstelle gefiltert werden, um die notwendigen Rettungsmittel festzustellen", erklärt Dr. Nicole Steinsieck, Ärztliche Leiterin Rettungsdienst der Stadt Osnabrück
Stroke Units sind spezialisiert
Bis zum Eintreffen der Rettungsdienstkräfte muss, wenn notwendig, erste Hilfe geleistet werden. Ist der Rettungsdienst vor Ort, wird der FAST-Test wiederholt und die Vitalparameter des Patienten überprüft. Die Auskunft über blutverdünnende Medikamente des Betroffenen sei laut Steinsiek außerdem hilfreich und wichtig. „Da Zeit gleich Gehirn (Time is brain) bedeutet, ist es so wichtig, dass Symptome richtig erkannt und der Betroffene schnell in ein spezialisiertes Krankenhaus gebracht wird", erklärt Schäbitz.
Schlaganfallpatienten werden in ein Krankenhaus mit einer Stroke Unit gebracht. Hier bietet der Zusammenschluss aus spezialisiertem Fachpersonal die besten Chancen auf weitergehende Diagnostik und Akutbehandlung mit einer Thrombolyse: Dabei wird das Blutgerinnsel aufgelöst. Diese Behandlung kann in den ersten Stunden nach einem Schlaganfall das Risiko für Bleibeschäden deutlich minimieren. Auch hier gilt also: Je weniger Zeit bis zur Behandlung verstreicht, desto größer ist die Chance für einen langfristigen Therapieerfolg!