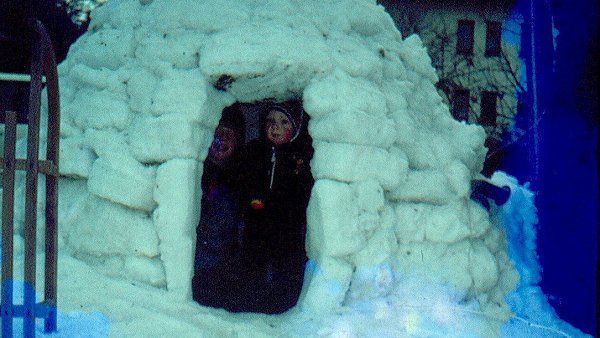Kreis Lippe/OWL. Während in den vergangenen Wochen die Alpenregionen meterhohe Schneefälle verzeichneten, gab es in OWL bisher nur wenig weiße Pracht. Ganz anders sah das vor 40 Jahren aus. Zunächst wurden im Dezember 1978 viele Menschen im äußersten Norden von einem dramatischen Temperatursturz und heftigen Schneefällen überrascht, zwischen den Feiertagen machte sich die Kälte dann langsam auf den Weg in den Süden.
Wir haben nach Ihren Erinnerungen aus der Zeit gefragt und einige an dieser Stelle zusammengetragen.
Hochschwanger im Schnee
Horst Peterjürgens aus Detmold erlebte den Wintereinbruch vor 40 Jahren im Südwesten Deutschlands.
„Meine hochschwangere Frau und ich waren über Weihnachten und Silvester zu Besuch bei meiner Schwester in Donaueschingen, also im Südwesten. Im Fernsehen sahen wir dann, wie die Schnee- und Kältewelle zwischen den Jahren langsam von Nord nach Süd heranrollte. Da wir rechtzeitig zum Schulbeginn wieder in Detmold sein mussten, machten wir uns wegen der Autofahrt nach Norden große Sorgen. In der Silvesternacht war Donaueschingen noch frostfrei. Am Neujahrsmorgen hatte der Winter dann auch die Baar und den Schwarzwald erreicht.
Aus Angst, alles könne noch schlimmer werden, starteten wir dann nach Norden, sobald es hell wurde. Es wurde eine lange Fahrt. Anfangs war noch nicht der Schnee das Problem, sondern nur die eingefrorene Scheibenwaschanlage. Aber je weiter wir nach Norden kamen, desto heftiger wurde der Schneefall und unsere Reisegeschwindigkeit immer langsamer. Mit der hochschwangeren Frau neben mir wollte ich nur noch eins: nach Hause. Darum haben wir uns auch nur eine Pause gegönnt.
Ganz schlimm wurden die Straßenverhältnisse, nachdem wir die Autobahn bei Warburg verlassen hatten. Der Straßenverlauf war kaum noch zu erkennen. Zwischendurch sahen wir immer Schilder nach Peckelsheim und dachten: Wann haben wir diesen Ort denn endlich passiert? Um 22 Uhr waren wir dann zu Hause. Es gab keine Geburt im Auto. Am wichtigsten war, dass unser erstes Kind die Horrorfahrt gut überstanden hatte."
Titanic-Ängste auf der Ostsee
Manfred Rydzynski aus Bielefeld verbrachte einen Teil des denkwürdigen Winters ausgerechnet in einem der ohnehin kühlsten Länder Europas: in Finnland. Chaotisch aber wurde aber erst die Rückreise.
„Im Februar 1979 haben meine jetzige Ehefrau und ich mich auf den Weg nach Finnland gemacht. Zum einen, um unsere guten Freunde zu besuchen, zum anderen, um uns zu verloben. Die Anreise erfolgte mittels Eisenbahn und Finnjet-Fähre. Auch Finnland erlebte in dem Jahr den kältesten Winter seit 150 Jahren. Die Hinfahrt verlief planmäßig. Am Zielort wurden wir von unseren Freunden in Empfang genommen. Trotz des extremen Winters verlief das Leben für die Finnen völlig unaufgeregt.
Als wir auf dem Rückweg waren, begann für uns die eigentliche „Katastrophe". Da die Ostsee zugefroren war, konnte der Finnjet nicht mit voller Kraft laufen. Seine Fähigkeiten als Eisbrecher waren gefordert. Nachts entwickelte sich bei einigen der 800 anwesenden Passagieren so etwas wie eine Panik, da das Anschlagen der dicken Eisschollen an der Bordwand in Höhe ihrer Kabinen offensichtlich ein Titanic-Gefühl auslöste. Äußerlich bot das Fährschiff mehr das Bild eines fahrenden Eisbergs.
Obwohl wir mit 12 Stunden Verspätung am Scandinavien-Kai in Travemünde anlegten, war man dort nicht in der Lage gewesen, die Gangway zu enteisen und gängig zu machen. Also mussten die 800 Passagiere mit Gepäck das Schiff tief unten über eine enge Entsorgungsluke verlassen. Diese Belastung war für ältere Passagiere sehr hoch, und ich kann mich erinnern, dass ein älteres Ehepaar kollabierte.
Ein Linienbus beförderte uns dann zum Bahnhof. Keiner der Reisenden hatte auch nur die geringste Ahnung, wie es weitergehen sollte. Ein Bediensteter des Hafens rief uns Fragenden noch hinterher, dass wir bloß einsteigen sollen und dass sowieso keiner weiß, wie es weitergeht. Auf dem dunklen Bahnhof stürzten die Menschenmassen in einen dunklen, ungeheizten Zug. Die Waggons waren total überfüllt mit erschöpften Menschen. Wir mussten noch vier lange Stunden in dem vereisten dunklen Zug ausharren, bis man eine Lokomotive aufgetrieben hatte. Nach einer weiteren stundenlangen Wartezeit kamen wir mit rund 24 Stunden Verspätung in Bielefeld an."

Wattwanderer im ewigen Eis
Wolfgang Lippek aus Lage liegt das Wattenmeer seit Jahrzehnten am Herzen, jährlich wanderte er bei Ebbe zu verschiedenen Inseln. Im klirrend kalten Februar 1979 glich eine seiner Nordsee-Touren einer Mission im ewigen Eis.
„Ich war schon 1971 für einige Monate als Vogelwärter auf Scharhörn mitten im Niedersächsischen Wattenmeer beschäftigt. Danach hat mich die Liebe zur Nordsee nicht mehr losgelassen, so dass ich fast alle Ostfriesischen Inseln zu Fuß durch das Wattenmeer erreicht habe. Auch im besagten Winter fuhr ich, gut ausgerüstet mit Stiefeln, die bis zur Hüfte reichten, nach Cuxhaven, um zur elf Kilometer entfernten Insel Neuwerk zu wandern.
Anfang Februar 1979 bot sich ein imposanter Anblick von bis zu drei Meter hohen Eisschollen. Das ganze Watt hatte sich – bis auf einen Priel, durch den ich gewatet bin – in ein Eismeer verwandelt, das mit der Flut nach oben gehoben wurde. Es sah aus wie in der Antarktis, und ich bin keiner Menschenseele begegnet. Als gefährlich habe ich es nicht empfunden. Doch es sollte keiner nachmachen, der keine Erfahrung im Watt hat."
Das Auto musste zwei Wochen warten
Rainer Rings aus Paderborn fuhr über die Weihnachtstage auf die nordfriesische Insel Pellworm – dass er sein Auto erst Wochen später wieder von dort abholen würde, ahnte er da noch nicht.
„Weihnachten 1978 wollte ich mit einem befreundeten Ehepaar und ihrem behinderten Kind auf der Insel Pellworm verbringen. Die Anfahrt war schon mühevoll, da es aufgrund aufkommenden Sturms zu erheblichen Schneeverwehungen gekommen war. Wir erreichten glücklich die Fähre in Nordstrand. Die Überfahrt war stürmisch. Wir hatten Glück, denn wie sich später herausstellte, war es die letzte Fahrt in jenem Jahr.
Auf der Insel angekommen wurde der Wind immer stärker. Nachdem der Sturm sich gelegt hatte, sind wir mühevoll mit selbstgebastelten Schneeschuhen zum Hafen gegangen. Dort war die Fähre beim Versuch, nach Nordstrand zu fahren, auf das Eis aufgelaufen, ebenso der Seenotrettungskreuzer. Die Passagiere mussten die Fähre über das Eis verlassen. Nun saßen wir alle in der warmen Hafenkneipe und tranken einen heißen Tee.
Nach ein paar Tagen verschlechterte sich die Versorgungslage und wir wurden aufgefordert, mit unserem Gepäck zum Dorfplatz zu kommen. Mit Bundeswehrhubschraubern wurden wir evakuiert und nach Nordstrand geflogen. Dort haben wir stundenlang herumgestanden, da unklar war, wie wir von dort weiterreisen konnten. Das Auto mussten wir auf Pellworm zurücklassen und sind mit der Bahn zurückgereist. Erst zwei Wochen später konnte ich das Auto nachholen."

Schneetreiben führt ins Liebesglück
Elisabeth Zender kommt ursprünglich aus Bayern – erst durch den strengen Winter vor 40 Jahren hat sie schließlich den Weg nach OWL gefunden, denn sie lernte im Schneechaos ihren Mann „so richtig" kennen, wie sie uns schreibt.
„Im Sommer 1978 hatte ich, in Würzburg lebend, im Zug meinen späteren Mann kennengelernt. Wir waren beide zu Silvester von Freunden in Flensburg eingeladen worden. Vorher wollte mein damaliger Freund mir noch sein Ferienhaus in St. Peter Ording zeigen. Auf der Rückfahrt Richtung Flensburg schneite es so stark, dass wir kaum durch die großen Schneewehen kamen. Wir suchten verzweifelt nach einer Übernachtungsmöglichkeit, aber die Hotels hatten alle geschlossen. Erst in der Gemeinde „Welt" fanden wir ein kleines Hotel, das geöffnet hatte. Dort quartierten wir uns ein. Am nächsten Tag gab es kein Weiterkommen mehr. Alle Straßen waren gesperrt.
Man konnte nicht mal mehr telefonieren und auf den Inseln konnten die Tiere nicht mehr versorgt werden. An Silvester feierten wir beide dann mit den Wirtsleuten. Es gab Gans, Ente, Wild und viele Leckereien und wir konnten nach Herzenslust essen, was wir wollten. Diese Silvesterfeier werde ich nie vergessen. Denn auf diese Weise lernte ich meinen Freund richtig kennen. Im Jahre 1980 haben wir geheiratet. So war der Schnee „schuld", dass ich in diese Region gezogen bin. Wir wollten nach Welt zurück und die Wirtsleute besuchen, doch mein Mann starb vor zwölf Jahren. Deshalb hat die Fahrt nie stattgefunden."
Kuriose Anfahrhilfe
Danièle Eidmann aus Lemgo wagte sich auf Sommerreifen über die vereisten Straßen in OWL. Das wurde der damaligen Referendarin just an dem Tag fast zum Verhängnis, an dem sie gar nicht hätte zur Arbeit fahren müssen.
„Ich war Referendarin am Geseker Gymnasium und musste jeden Morgen mit meinem kleinen NSU Prinz von Detmold über Schlangen und Bad Lippspringe nach Geseke fahren. Gegen das Beschlagen der Windschutzscheibe hatte ich einen zusätzlichen inneren Ventilator montiert. Als Studentin fuhr ich natürlich mit Sommerreifen. Da ich bis 7:45 Uhr eintreffen musste, fuhr ich immer 5:45 Uhr in der Frühe los. In Bad Lippspringe konnte ich die B 1 überqueren und die sogenannte„Nebenstrecke Kassel" nehmen. Dieser Weg war schneller und einfacher als über Paderborn. Bis ich dort ankam, war die Straße geräumt, allerdings wurde sie mit der Zeit immer schmaler, bis sie schließlich zur Einbahnstraße wurde. Ich fragte mich eines Tages, was ich täte, wenn mir jemand entgegenkäme. Aber so verrückt wie ich war niemand und so hatte ich nie Probleme.
So fuhr ich mehrere Wochen und kam immer pünktlich an, allerdings drei Mal umsonst. Geseke gehörte zum Schulbezirk Soest und bekam gelegentlich schulfrei wegen Schneeverwehungen oder Eisregen. Es wurde in den Nachrichten frühmorgens bekannt gegeben, aber da war ich schon längst unterwegs und hatte natürlich kein Autoradio. Eines Morgens kam ich auf dem spiegelglatten Schulparkplatz an, der Hausmeister sah mich verdutzt an und fragte, was ich hier wolle. Die Schule sei geschlossen. Also konnte ich zurückfahren. Es erwies sich als schwierig, da ich nicht vom Parkplatz wegkam. Ich erkundigte mich am Bahnhof, wie ich nach Detmold käme – frühestens um 12 Uhr wäre ich zurück. „Das schaffe ich mit dem Auto auch", dachte ich. Also probierte ich, mit Hilfe meiner Gummimatten das Auto vom Parkplatz wegzubekommen. Mit Erfolg. Mit einem Tempo von 20 Kilometern pro Stunde fuhr ich gut drei Stunden und kam trotzdem eine halbe Stunde früher nach Hause als mit dem Zug."
Von der Welt abgeschnitten
Rüdiger Sturhahn aus Lieme war zu der Zeit als Soldat im Norden stationiert. Doch der Weg zurück in die Kaserne erwies sich als schwierig.
"Es war der 31. Dezember 1978. Gegen 18 Uhr verließen meine Freundin - heute ist sie meine Frau - und ich das Haus meiner Eltern in Lieme, um einer Party zu gelangen. Das Wetter war trocken und nichts sah nach einer Schlechtwetterfront aus. Darum wurde eher auf gemütliche Kleidung und Tanzschuhe geachtet, als auf winterfestes Schuhzeug und die entsprechende Winterbekleidung. Eine Entscheidung, die sich zu gegebener Zeit noch als Fehler herausstellen sollte.
Gegen 23 Uhr war ein erster, leichter bis mäßiger Schneefall zu sehen. Beim Gehen mit Tanzschuhen musste man schon aufpassen. Um Mitternacht lagen bereits etwa zehn Zentimeter Schnee und ein Ende des Schneefalls war nicht aufzusehen. Um kurz nach 3 Uhr morgens machten wir uns auf den Heimweg. Ein Fußweg, der in der Regel in 20 Minuten zu schaffen ist. Wir brauchten fast eine Stunde.
In den nächsten Tagen kam die Meldung, dass im Norden Chaos herrschte. Die Anreise zur Kaserne in der Nähe von Kiel, in der ich meinen Grundwehrdienst leistete, war nicht möglich. Erst drei Tage später konnte ich einen Zug in Richtung Ostsee nehmen. Was mich auf dem Weg dorthin und auch dort erwartete, war irre. Ich hatte nicht das Gefühl in Deutschland zu sein, sondern eher in der sibirischen Taiga. Schnee und Schneeverwehungen wohin man blickte. Ein Bergepanzer der Bundeswehr hatte die Verbindung zur Kaserne in Lütjenburg frei bekommen und ein Sonderbus fuhr. In diesem Bus saß ich und schaute voller Angst und Bewunderung nach draußen. Der Schnee türmt sich an den Straßenrändern über das Dach des Busses.
Erst in den darauffolgenden Tagen, konnte ich das Ausmaß des verheerenden Schneechaos richtig einschätzen. Ganze Dörfer waren in der Umgebung von Lütjenburg von der Außenwelt abgeschnitten. Die Straßen waren auf noch Tage und Wochen später kaum oder nicht zu passieren. Wir Soldaten waren über eine langen Zeitraum im unermüdlichen Einsatz, um wenigstens ein bisschen normales Leben wieder in die Region zubringen. Die Menschen waren so dankbar für jegliche Unterstützung die sie erhielten. Die Einsatz als Bundeswehrsoldat machte Sinn, ja sogar Freude."