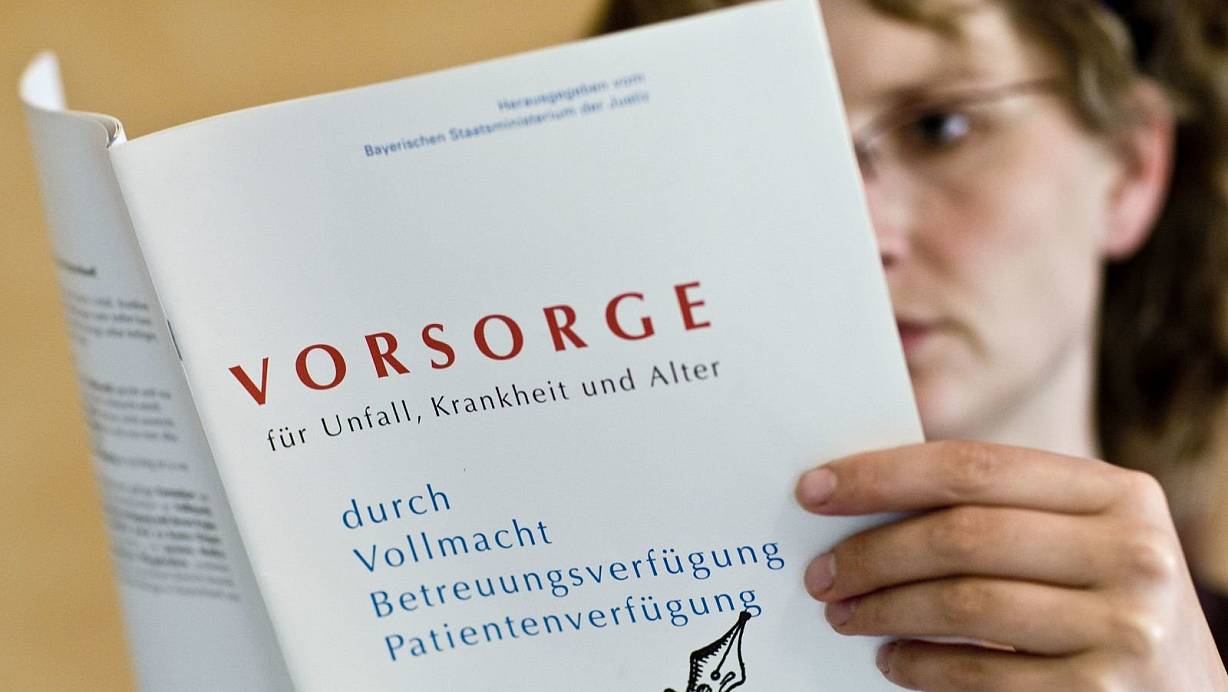Bielefeld. Obwohl jeder die Möglichkeit hat, frei zu entscheiden, ob und welche ärztlichen Behandlungsmethoden im Notfall erwünscht sind, haben nur ein Viertel der Bundesbürger eine Patientenverfügung erstellt. Selbst Patienten, die in gesunden Tagen für den Krankheitsfall vorsorgen, scheitern ausgerechnet in der letzten Lebensphase mit ihrem Willen. Wie viel Klärungsbedarf bei diesem Thema herrscht, hat unsere Telefonaktion mit der Westfälischen Notarkammer gezeigt. Die wichtigsten Fragen der Leser haben die Bielefelder Notare Martin Mücke, Ralf-Bernd Rabe und Peter von Thunen zusammengefasst.
Worin bestehen die Unterschiede zwischen Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung?
Mit einer Vorsorgevollmacht wird eine gerichtliche Anordnung einer Betreuung überflüssig. Sie ermächtigt eine Person, meist aus dem eigenen persönlichen Umfeld, Entscheidungen zu treffen, wenn man selbst nicht mehr kann.
Eine Betreuungsverfügung wiederum kann eine gerichtlich anzuordnende Betreuung in Bezug auf persönliche Wünsche in der Betreuung beeinflussen. Der Betreuer wird hier, anders als der Vorsorgebevollmächtigte, gerichtlich überwacht. Spezielle Behandlungswünsche für den Fall, dass jemand beispielsweise bewusstlos ist, werden in einer Patientenverfügung festgehalten. Darunter fallen etwa Wünsche zu lebensverlängernden oder schmerzlindernden Maßnahmen. Mit einer Patientenverfügung ist also noch nicht geregelt, wer im Ernstfall die Betreuung übernimmt. Hierzu bedarf es einer Vorsorgevollmacht.
Muss die Erteilung einer Vollmacht zwingend notariell beurkundet werden?
Grundsätzlich ist eine Vollmachterteilung auch privatschriftlich zulässig. Doch können Angelegenheiten, die Grundstücke und Immobilienbesitz betreffen, nur mit notariell beglaubigter oder beurkundeter Vorsorgevollmacht geregelt werden. Liegt eine solche nicht vor, ist es unumgänglich, das Betreuungsgericht und einen Betreuer einzuschalten.
Was ist bei der Gestaltung des Umfangs einer Vollmacht zu beachten?
In vermögensrechtlichen Angelegenheiten kann eine Generalvollmacht erteilt werden. Folglich kann der Bevollmächtigte genau so handeln, wie der Vollmachtgeber selbst. Ausgeschlossen sind dabei höchstpersönliche Rechtsgeschäfte wie eine Heirat, bei der eine Vertretung unzulässig ist.
In persönlichen und sonstigen nichtvermögensrechtlichen Angelegenheiten ist jedoch eine dezidierte Beschreibung der Bevollmächtigung notwendig. Das betrifft zum Beispiel Gesundheitsregelungen, Entscheidungen zur Aufenthaltsbestimmung und Unterbringung, Entscheidungen über freiheitsentziehende und -beschränkende Maßnahmen sowie Entscheidungen über ärztliche Zwangsmaßnahmen.
Wer kann als Bevollmächtigter bestimmt werden? Ist es möglich, einen Rechtsanwalt oder auch einen Notar als Bevollmächtigten einzusetzen?
In den meisten Fällen ist wichtig, dass ein Bevollmächtigter voll geschäftsfähig ist. Jedoch können auch Kinder, die das 7. Lebensjahr vollendet haben, bevollmächtigt werden. Das kann bedeutsam sein, wenn beispielsweise Eltern ihre fast volljährigen Kinder als Bevollmächtigte einsetzen wollen. Ansonsten bestehen keine besonderen Voraussetzungen. Wie fast jede andere Person können also auch Notare oder Rechtsanwälte bestimmt werden. Lediglich derjenige Notar ist ausgeschlossen, der die notarielle Vorsorgevollmacht beurkundet oder beglaubigt. Bei einem bevollmächtigten Rechtsanwalt sollte in die Vollmacht aufgenommen werden, ob und in welcher Höhe dieser für die Tätigkeit als Bevollmächtigter vergütet werden soll.
Gilt eine Vollmacht auch über den Tod hinaus?
Es sollte ausdrücklich festgehalten werden, dass ein Bevollmächtigter nach dem Versterben des Vollmachtgebers weiter handeln darf. Sinnvoll ist in vielen Fällen eine Nachlassvollmacht, die den zeitlichen Zwischenraum zwischen dem Tode des Vollmachtgebers und der Feststellung der Erbfolge überbrückt.