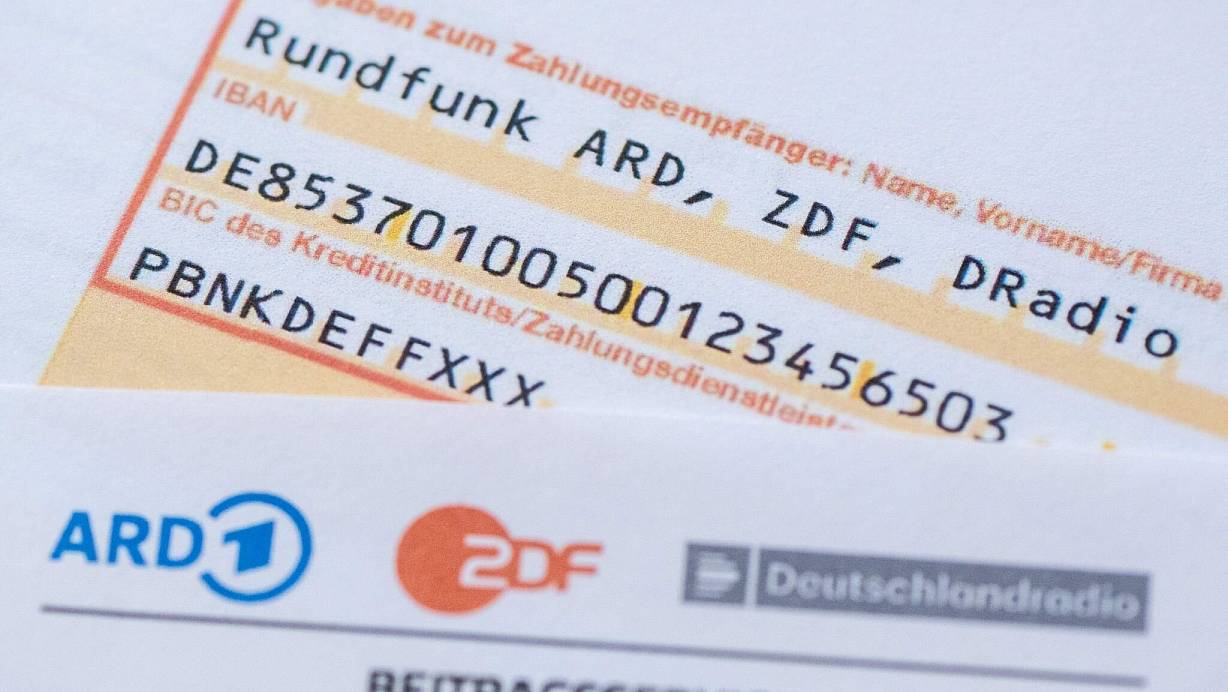Leipzig (dpa/epd). Der Rundfunkbeitrag bleibt vorerst bei 18,36 Euro pro Monat. Die Ministerpräsidenten verschieben eine Entscheidung zur Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender. Im Dezember soll es weitere Beratungen geben, bestätigten mehrere Länder. Wegen des Widerstands „etlicher Länder“ sei die Anhebung des Beitrags für die öffentlich-rechtlichen Sender von der Ministerpräsidentenkonferenz nicht beschlossen worden, erklärte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Freitag, 25. Oktober.
Große praktische Konsequenzen der gestoppten Erhöhung erwarte er nicht, erklärte Bovenschulte. Wenn es nicht noch zu einer Verständigung der Länder komme, sei davon auszugehen, dass die Sender die Beitragserhöhung in Karlsruhe einklagten – „mit sehr hohen Erfolgsaussichten“.
Die Länderchefs einigten sich bei ihrem Treffen in Leipzig zugleich auf umfangreiche Reformen für ARD und ZDF. Am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz begrüßte der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Verständigung auf die Rundfunkreform als „dringend erforderlich“.
Der Reformstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht unter anderem vor, mindestens 16 ARD-Hörfunkkanäle und mehrere Fernseh-Spartensender von ARD und ZDF einzusparen. Der Kultursender 3sat, den ARD und ZDF mit dem Österreichischen Rundfunk (ORF) und der Schweizer SRG SSR betreiben, soll weitgehend in den deutsch-französischen Sender Arte überführt werden. Gegen die mögliche Einstellung von 3sat hatten zahlreiche Kulturschaffende und Politikerinnen und Politiker protestiert. Ebenso sollen demnach kleinere TV-Sender, die klassisch im Fernsehen ihr Programm fortlaufend ausstrahlen, wegfallen.
Ziel der Reformpläne ist es, effizientere Strukturen zu schaffen und Kosten einzusparen – auch mit Blick auf die Entwicklung des Rundfunkbeitrags. So soll die Zahl der Radioprogramme in der ARD früheren Plänen zufolge sinken.
Der nordrhein-westfälische Medienminister Nathanael Liminski verteidigte die Streichpläne. „Wir schaffen klare Strukturen in den öffentlich-rechtlichen Anstalten und bauen unnötige Doppelstrukturen ab“, sagte der CDU-Politiker gegenüber „NW.de“. Der Auftrag dürfe nicht in die Spartenkanäle abgeschoben werden. Früher habe man die Spartenkanäle auch dafür gebraucht, Sendungen aus dem Hauptprogramm noch einmal zu zeigen. In Zeiten von Mediatheken sei das nicht mehr notwendig.
Lesen Sie auch: Größte Reform seit Gründung: Was bei ARD und ZDF bald wegfallen könnte
Wird der Streit um den Rundfunkbeitrag ein Fall für Karlsruhe?
Die offene Frage des künftigen Rundfunkbeitrags könnte allerdings vor dem Bundesverfassungsgericht landen, wenn ARD, ZDF und Deutschlandradio klagen. Denn die neue Beitragsperiode beginnt am 1. Januar 2025. Dann müsste der Rundfunkbeitrag, den Haushalte und Firmen zahlen, gemäß einer Experten-Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) von monatlich 18,36 Euro um 58 Cent auf 18,94 Euro steigen. Dahinter steht ein verfassungsrechtlich verbrieftes Verfahren.
Die Länderchefs müssen sich eigentlich eng an der Empfehlung orientieren. Schon beim vorigen Mal hatte Sachsen-Anhalt vor dem Bundesverfassungsgericht eine Niederlage kassiert, weil sich das Land gegen eine empfohlene Erhöhung gestellt hatte.
In den vergangenen Monaten lagen die Positionen beim Rundfunkbeitrag weit auseinander. Länder wie Sachsen-Anhalt und Bayern sprachen sich immer wieder gegen eine Anhebung aus. In dieser Frage braucht es aber ein einstimmiges Votum. Weicht nur ein Regierungschef ab, kann eine Erhöhung nicht auf den Weg gebracht werden.
Die Gegner einer Erhöhung argumentierten, die Häuser hätten nicht genug getan, um sich selbst zu reformieren. Aktuell beträgt der Jahresbetrag für den Rundfunk neun Milliarden Euro. Befürworter sagten, Reformen würden erst mit der Zeit für Einsparungen sorgen. Deshalb müsse man den Häusern das Beitragsplus – auch mit Blick auf die Inflation – zugestehen.
Was ist der nächste Schritt?
Damit die strukturellen Reformen greifen können, müssen noch alle Landtage zustimmen. Lehnt auch nur ein Landesparlament das Papier ab, können die Änderungen in den Staatsverträgen zum Rundfunk nicht in Kraft treten. Die Reform könnte nach früheren Länderangaben von Sommer 2025 an umgesetzt werden.
In Staatsverträgen legen die Bundesländer seit Jahrzehnten fest, welchen Auftrag und welche Struktur der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. Es geht etwa darum, wie viele Rundfunkanstalten es gibt und welche Programme angeboten werden.
Der Rundfunkbeitrag ersetzt seit 2013 die frühere Rundfunkgebühr, auch „GEZ-Gebühr“ genannt. Seitdem zahlen alle Haushalte und Betriebsstätten die Abgabe für öffentlich-rechtliche Sender, unabhängig davon, ob sie Empfangsgeräte wie Fernseher oder Radio besitzen. Grundgedanke der Reform war, dass in Zeiten von Smartphones nicht mehr der Besitz eines „Rundfunkempfanggeräts“ für die Gebührenpflicht entscheidend sein kann.