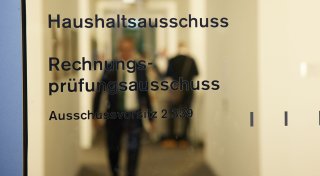Man bekommt das im Kopf schwer zusammen: Seit Monaten ist von Rekordschulden die Rede - wenn es aber um Sanierungsfälle, Bauprojekte und Bahntrassen geht, fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Es braucht einen etwas tieferen Blick in die Staatsfinanzen, um das zu verstehen.
Die 500 Milliarden Euro Sondervermögen, also Extra-Schulden, sind für zusätzliche Projekte gedacht wie Straßen, Schienen und Digitalisierung, die bislang noch nicht eingepreist waren. Das heißt, wenn für eine bereits geplante Brückensanierung das Geld fehlt, dürfen die zusätzlichen Milliarden dafür nicht verbraucht werden.
Grundsätzlich ist das eine gute Regelung. Nur so gibt es die Chance, die Versäumnisse der Vergangenheit aufzuholen und den so oft beklagten Stau an Investitionen aufzulösen. Zugleich zwingt die Regelung die Regierung zur Haushaltsdisziplin. So weit die Theorie.
Milliardenlöcher trotz Buchungstricks
In der Praxis wachsen die Etats für die Bahn und die Autobahnen dank des Sondervermögens auf. Die für schon geplante Projekte vorgesehenen Geldtöpfe wurden aber zusammengestrichen. Damit hat sich der Bund Luft im Haushalt verschafft, um zusätzliche Konsumausgaben zu finanzieren - zum Beispiel einen höheren Rentenzuschuss für eine weiter steigende Mütterrente, Steuererleichterungen für die Gastronomie und eine höhere Pendlerpauschale.
Zum Thema: Was man über den Bundeshaushalt 2026 wissen sollte
Diese zusätzlichen Ausgaben helfen den betroffenen Gruppen, ihren Alltag zu stemmen und im Fall der Mütterrente belohnen sie eine Lebensleistung. Sie leisten aber keinen echten Beitrag dazu, Deutschlands Wirtschaft und Infrastruktur fit für die Zukunft zu machen. Erschwerend kommt hinzu, dass in den Haushalten für die kommenden Jahre trotz der Buchungstricks noch Milliardenlöcher klaffen.
Gute Schulden, schlechte Schulden
Es ist Zeit für mehr Disziplin bei den Staatsausgaben. Schulden für notwendige Zukunftsinvestitionen aufzunehmen, die der Wirtschaft Wind unter die Flügel geben, der Sicherheit des Landes dienen und den Bürgern das Leben leichter machen, sind sinnvoll. Geld aus neuen Schulden indirekt in den Staatskonsum fließen zu lassen, ist hingegen wirklich zukunftsvergessen. Kinder und Enkel müssen dann in einem sanierungsbedürftigen Land Schuldenberge abtragen. Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil sollten die entsprechenden Warnungen des Bundesrechnungshofs ernster nehmen.
Über diese Zusammenhänge ist in den vergangenen Monaten zu wenig gesprochen worden. Stattdessen wurden viele Scheingefechte um den Sozialstaat gefochten. Knapp die Hälfte des Bundeshaushalts 2026 fließt in den Sozialetat, 243 Milliarden Euro. Das ist eine gigantische Summe, allerdings wird etwa die Hälfte davon benötigt, die erworbenen Ansprüche der Rentnerinnen und Rentner zu erfüllen.
Den Sozialstaat müssen wir uns leisten. Er ist sogar im Grundgesetz festgeschrieben. Wir müssen ihn uns aber auch leisten können. Vor diesem Hintergrund ist eine Reform des Bürgergelds dringlich, die all jene Empfänger in Arbeit bringt, die einer Erwerbsarbeit nachgehen können. Weniger Bürgergeldbezieher bedeuten nicht nur weniger Ausgaben für den Staat, sondern auch mehr Steuereinnahmen und mehr Einnahmen für die Sozialkassen. Bei der Reform muss es nicht um Kürzen, Streichen, Strafen gehen. Es braucht aber die klare Botschaft, dass der Sozialstaat vor allem für Schicksalsschläge und in Notlagen zuständig ist. Leistungen, die zwar wünschenswert, aber nicht zwingend sind, gehören auf den Prüfstand. Das gilt auch für das Gesundheitssystem. Finanzminister Klingbeil hat bei der Einbringung des Haushalts „unbequeme Entscheidungen“ angekündigt. Die Regierung wird ein paar davon treffen müssen, um das für ein funktionierendes Staatswesen so wichtige Wirtschaftswachstum wieder in Gang zu setzen. Nur her damit!