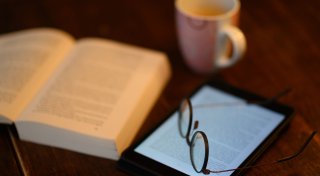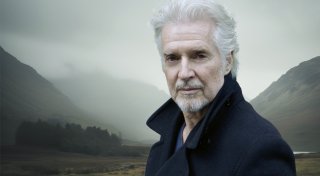nur wenig erfunden" | © KULTUR
Frankfurt/Bielefeld. Montagabend ist die Autorin Ursula Krechel (64) mit dem Deutschen Buchpreis für ihren Roman "Landgericht" geehrt worden. "Bald poetisch, bald lakonisch, zeichnet Krechel präzise ihr Bild der frühen Bundesrepublik – von der Architektur über die Lebensformen bis hinein in die Widersprüche der Familienpsychologie", heißt es in der Begründung der Jury. Der Roman "Landgericht" erzählt die Geschichte des Richters und Juden Dr. Kornitzer, der nach dem Zweiten Weltkrieg in die Bundesrepublik zurückkehrt. Stefan Brams sprach mit der Autorin wenige Tage vor der Preisverleihung über ihren Roman.
Frau Krechel, in Ihrem Roman "Shanghai, fern von wo" aus dem Jahr 2008 ging es um die Emigration während der Nazizeit. In "Landgericht" um die Remigration. War diese Fortsetzung des Themas geplant?
KRECHEL: Nicht von Anbeginn an, aber in der letzten Phase meines Shanghai-Romans haben sich meine Recherchen so verdichtet, dass mir klar wurde, mein nächster Roman wird sich mit der Rückkehr von Emigranten in die Bundesrepublik beschäftigen.
Was hat Sie an dem Thema gereizt?
KRECHEL: Emigration und Vertreibung sind ein großes Menschheitsthema, das sich von Anbeginn an durch die Geschichte der Menschheit zieht. Diese traumatische Situation zieht mich schreibend und nachdenkend einfach sehr viel mehr an als der Roman aus dem deutschen Reihenhaus.
Ihre Hauptfigur, der Jurist Dr. Kornitzer, kommt aus der Emigration zurück und Sie lassen ihn mit dem Satz auftreten "Er war angekommen. Angekommen, aber wo?" Doch ankommen wird er nicht. Warum wurde es den Remigranten so schwer gemacht hierzulande?
KRECHEL: Der Faschismus hat in den Seelen vieler Menschen so starke Verheerungen angerichtet, dass ihnen schlicht die Fähigkeit, über den eigenen Tellerrand zu schauen, über die eigene "Niederlage" hinaus zu denken und zu sehen, abhanden gekommen war. Zudem waren die Menschen zwölf Jahre lang indoktriniert worden, so dass sie faktisch nichts mehr wussten über die Welt außerhalb ihrer Welt des Schreiens und Brüllens, eine Welt, in der Menschen ihrer Rechte beraubt und ausgesetzt waren im Nirgendwo.
Dennoch erschreckt die große Larmoyanz vieler Deutscher, die sich selbst als Opfer des Krieges sehen, aber kaum Empathie für die wirklichen Opfer aufbringen?
KRECHEL: Alexander Mitscherlich hat das ja in seinem Buch "Die Unfähigkeit zu trauern" deutlich herausgearbeitet. Getrauert wurde in der Tat um das Eigene, aber nicht um die anderen. Wenn ich früher als Kind in andere Wohnungen kam, dann stand dort oft, wo früher das Hitler-Bild war, nun ein mit Trauerflor versehenes Bild vom gefallenen Bruder, Vater, Schwager oder Sohn in Wehrmachtsuniform. Es ging auch in all den feierlichen Reden, an die ich mich erinnere, immer nur um die in einem Angriffskrieg gefallenen eigenen Soldaten. Niemals ging es um die wahren Opfer dieses Regimes, dieses Krieges. In dieser Atmosphäre bin ich aufgewachsen, ihrer Ursache wollte ich schon früh nachspüren.
Gibt es ein reales Vorbild für Dr. Kornitzer und seine Familie?
KRECHEL: Ja, mein Roman basiert auf einem wahren Fall und der Akte eines Remigranten, der versucht, als Richter hier wieder Fuß zu fassen. Diese Rückkehrerakte zu finden, war ein Glücksfall für mich.
Sie zitieren ausführlich aus der Akte. Hatten Sie keine Angst, dass das die Leser ermüden könnte?
KRECHEL: Nein, denn die kalte Sprache der Dokumente zeigt am besten, wie die Remigranten empfangen wurden. Es ist die Gewalt, die diesen Dokumenten eingeschrieben ist, die meinen Roman viel stärker, lebendiger und authentischer macht, als wenn er allein auf meiner Fantasie basieren würde.
Sie haben in diesem Zusammenhang den für einen Romancier erstaunlichen Satz formuliert "Ich habe versucht, so wenig wie möglich zu erfinden". Warum erfinden Sie so ungerne?
KRECHEL: Ich erfinde gerne! Mir erschien es aber in diesem Fall eitel und rechthaberisch, mich als brillante Erzählerin mit meiner Fantasie vor die Menschen zu stellen, die im Dunkeln standen und zum Schweigen gebracht wurden. So kann ich ihnen viel besser eine Stimme geben und ein Denkmal setzen.
Ihr Buch endet pessimistisch. Dr. Kornitzer reibt sich an den Verhältnissen auf. Die Familie findet nicht wieder zusammen.
KRECHEL: Ja, das alles ist ein Fiasko. Die Familie überlebt und überlebt doch nicht zusammen als Familie. Sie sind ähnlich wie die Opfer der Mafia gleichsam schweigend einbetoniert worden in die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik. In dem ich mit meinem Roman diesen Beton zertrümmere, lege ich ihre Geschichte wieder frei.
Sie haben die Tochter Ihres Helden in England ausfindig gemacht, wo sie heute 77-jährig lebt. Was hält Sie von ihrem Buch?
KRECHEL: Das kann ich noch nicht sagen, denn der Kontakt ist noch sehr frisch. Zurzeit liest sie meinen Roman. Ich bin sehr gespannt auf unser Treffen im November hier in Deutschland.
Kehren Sie nach "Landgericht" wieder zur Lyrik zurück?
KRECHEL: Was als nächstes erscheint, weiß ich noch nicht, aber ich schreibe nach wie vor wahnsinnig gerne Gedichte. Es ist eine Notwendigkeit. Und es gibt einen Plan für einen neuen Roman. Aber was daraus wird, ist noch offen.