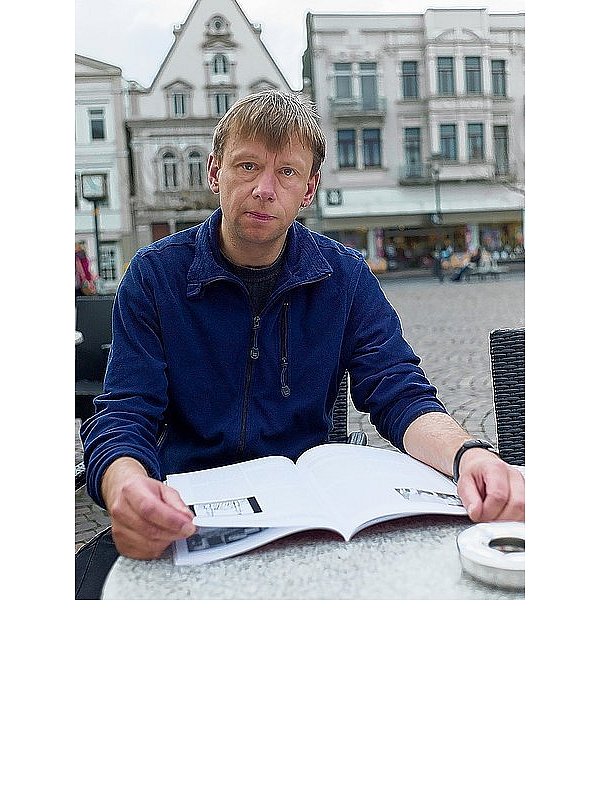
Herford. Seit Anfang 2011 arbeitet Karsten Wilke für die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Detmold. Zu seinen Aufgaben gehören die Beratung beim Umgang mit rechtsextremen Vorfällen, die Netzwerk-Arbeit und die Beobachtung der Szene. Sein Rat ist seit Aufdeckung der rechtsterroristischen Mordserie des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) gefragt, obwohl es im Kreis in Sachen rechtsextremer Aktivitäten relativ ruhig ist.
"Für mich ist es nicht überraschend, dass Rechtsextremisten zur Waffe greifen", sagt Wilke: "Die Bereitschaft zur Gewaltanwendung ist zentraler Teil der Weltanschauung." Das zeige sich in allen Bereichen rechter Aktivitäten wie bei Demonstrationen, Konzerten oder Fußball-Fanreisen. Ziel sei die homogene Volksgemeinschaft, aus der Fremdes mit allen Mitteln herausgehalten werden soll. Die Rechten sehen sich dabei als Elite, eine Vorhut, deren Mission es sei, in "Notwehr" das eigene Land zu schützen.
Der NSU entstand in den 1990er Jahren, als es eine Vielzahl kleiner NS-Organisationen gab. In dieser Zeit fand das Trio die Helfer, die die Mörder in den folgenden Jahren unterstützten. Die Kontakte überstanden die Partei- und Organisationsverbote, die Wilke für sinnvoll hält, "wenn sie gut gemacht sind, auch Ausweich- und Auffangorganisationen mit betreffen und von einer gesellschaftlichen Debatte über die Ursachen des Rechtsextremismus flankiert werden." So sei der 1992 gegründete Verein "Gedächtnisstätte" beim Verbot des Vlothoer Collegium Humanum (CH) 2008 nicht beachtet worden. Dem war es bereits 2005 gelungen, im sächsischen Borna ein größeres Anwesen zu kaufen, in dem viele der Aktiven aus dem CH weiter aktiv seien.
Nur wenige hätten sich über eine Einschätzung zu den Taten der NSU hinaus an ihn gewandt, um etwas über die Ursachen zu erfahren, sagt Wilke. Themen wie die Konflikte um die Moscheebauten werden in der Mitte der Gesellschaft gesetzt und von rechtspopulistischen Gruppierungen wie "pro NRW" aufgenommen. "Wenn die Demokraten nicht eindeutig Stellung beziehen, gelingt es solchen Gruppen, sich als legitime politische Akteure zu etablieren." Die zunehmende Islamfeindlichkeit habe in manchen rechten Zirkeln inzwischen den Antisemitismus als Feindbild ersetzt, auch wenn das Thema in der Rechten noch kontrovers diskutiert werde. Wie anknüpfungsfähig das in der Gesellschaft ist, zeige die Resonanz auf Sarrazins Thesen.
Die NPD spiele in OWL so gut wie keine Rolle. Anders schätzt Wilke die Bedeutung der "Freien Kameradschaften" (FK) ein. Sie haben die festen Organisationen abgelöst und sprechen mit ihren erlebnisorientierten Angeboten vorwiegend Jugendliche an. Während Leo Köhler vom Bielefelder Staatsschutz vor dem Integrationsrat der Stadt Gütersloh erklärte, dass es in Gesamt-OWL keine festen Strukturen der rechten Szene und nur etwa 50 Anhänger neonazistischer Ideen gebe, berichtet Wilke, dass sich in Lippe die "Freien Kräfte Detmold" etabliert haben, zu deren Umfeld allein er etwa 30 bis 40 Personen rechnet.
Die FK-Detmold seien eng mit dem Netzwerk "Westfalen-Nord" verknüpft, das bundesländerübergreifend in Südniedersachen und OWL agiere. "Der Name bezieht sich auf die alte geografische Gliederung zur Zeit des NS", erklärt Wilke. Praktisch führe das dazu, dass die Rechten bei Aktionen einfach über die Grenze wechseln, was die Strafverfolgung erschwere. "Dass der Staatsschutz kaum Strukturen erkennt, wundert mich nicht", sagt Wilke, denn genau das sei das Prinzip der freien Kameradschaften: "Die Szene kommt zunehmend ohne Führer aus. Die Kompetenzen sind so stark vergemeinschaftet, dass sich die Gruppen aus sich selbst erneuern – selbst wenn zentrale Personen aussteigen oder länger im Gefängnis sitzen." Für die Opfer rechter Gewalt, sei es jedoch unerheblich, ob sie von Mitgliedern einer Organisation oder eines losen Zusammenschlusses verletzt worden seien.