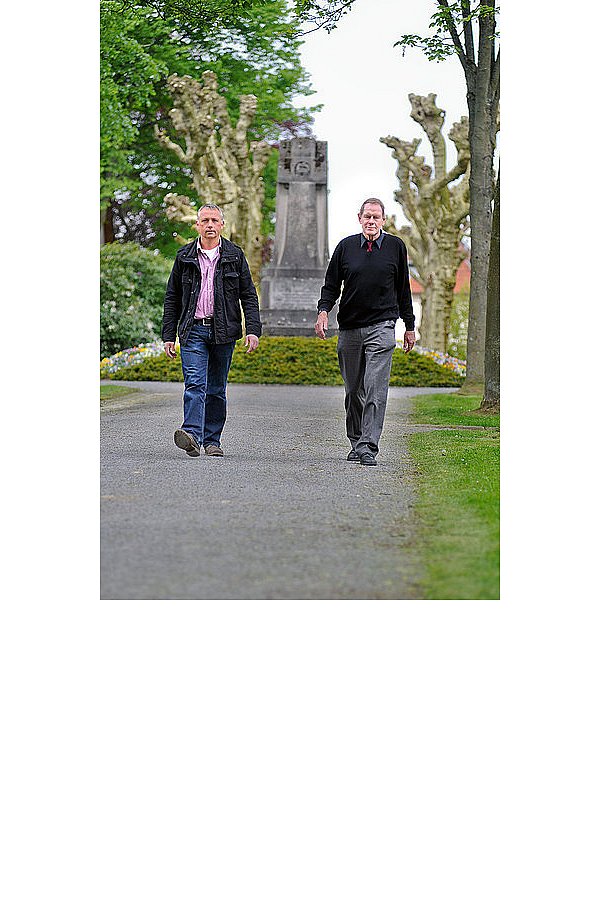
Herford. Wieso eigentlich dieser Name: Erika-Friedhof? "Das war eine ungeplante Namensgebung, denn das erste Grab war das der zwölfjährigen Erika Goldlücke. Sie wurde vor 100 Jahren, im April 1914, hier beerdigt", sagt Gärtnermeister Hans-Jörg Krauß. Damals lag der Friedhof der Marien-Kirchengemeinde weit vor den Toren der Stadt an der Vlothoer Chaussee auf dem Stiftberg.
Dorthin war der Festzug über die staubige Straße vom Gotteshaus, angeführt von einem Posaunenchor, am 1. Ostertag gezogen. "Damals war dieses Datum noch mehr in den Köpfen der Gläubigen verankert, es war die Zeit von Tod und Auferstehung", sagt Dieter Blanke, Vorsitzender des Presbyteriums.
Seit diesem Ostertag 1914 haben mehr als 14.000 Menschen ihre letzte Ruhestätte auf dem Friedhof mit Parkcharakter gefunden. Dreimal musste der Gottesacker erweitert werden.
Erst 1922 kam die erste Friedhofskapelle hinzu, bis dahin wurden die Verstorbenen direkt von zu Hause auf den Friedhof überführt. Vor fünf Jahren wurden die Gebäude und der Parkplatz erweitert.
Treibende Kraft hinter dem neuen Friedhof war vor hundert Jahren Pastor Adolf Vogelsang. Er hatte auch die Verhandlungen mit Colon Caspar Tappe über den Grunderwerb von damals 1,9 Hektar eingeleitet. Kaufpreis: stolze 24.553 Mark. Mittlerweile erstreckt sich der Friedhof über ein Areal von sieben Hektar, also 70.000 Quadratmeter. Nicht alles ist belegt, es gibt noch Reserveflächen.
4.000 Grabstätten mit 15.000 Lagerplätzen umfasst die aktuelle Kapazität des Erika-Friedhofes. Aktueller Preis für eine Grabstätte: 1.980 Euro für die Dauer von 30 Jahren. Es geht aber auch günstiger: 1.730 Euro für ein Urnengrab inklusive Grabplatte und Pflege. Hier liegt das Team um Gärtnermeister Krauß voll im Trend.
"Die Menschen haben immer noch das Bedürfnis nach einer Grabstätte – aber sie soll wenig Arbeit machen", sagt Krauß. Deswegen tritt die traditionelle Erdbestattung immer mehr zugunsten von kleineren Urnengräbern – die oft auch von den Angehörigen gepflegt werden – in den Hintergrund.
Familienbegräbnisse werden umgewandelt, der Parkcharakter ist jedoch geblieben. Die kiesbestreuten Wege ziehen sich wie ehedem durch die Anlage. "Viele Bürger geben ihre Familiengrabstätten auf und kaufen sich Grabstätten, die von der Friedhofsverwaltung gepflegt werden", weiß Krauß.
Die Möglichkeiten, die auf dem Erika-Friedhof erdacht werden, sind ebenso vielfältig wie interessant für andere Friedhofsverwaltungen. "Zu uns kommen viele Kollegen aus der Region, um sich die Umsetzung der Ideen anzuschauen", sagt Krauß. Die Marien-Kirchengemeinde als Trendsetter?
"Ja, man kann das schon so sagen. Darauf sind wir auch ein bisschen stolz", sagt Krauß. Stolz auf die Idee, eine Stele in die Mitte einer ehemals traditionellen Grabstätte zu setzen. Rundherum im Boden versenkt die Urnen, begrenzt mit einem Eckchen für Eisbegonien oder Tagetes. "Das ist leicht zu pflegen. Entweder von uns oder den Angehörigen", sagt Krauß. Das Gros der Fläche wird überwuchert von Golderdbeeren, ganzjährigen Bodendeckern.
Ein Stückchen weiter in Richtung Süden steht eine Zeder. Unter ihr ruhen sechs Urnen, an den äußeren Ecken des umschließenden Kreises sind noch einmal vier Urnen ins Erdreich eingelassen.
Nichts wirkt aufgesetzt oder fehl am Platz. "Wir haben das Bodenständige beibehalten", sagt der Gärtnermeister. Eine Schattenseite hat die Moderne aber auch: Je kleiner die Grabstätten, desto mehr Grün muss von der Verwaltung gepflegt werden. Das treibt die Kosten hoch.
Die Ideen für neue Bestattungsformen entwickeln sich beständig. Eine Messe als Inspirationsquelle gibt es nach Aussage des Gärtners nicht.
An diesem Wochenende wird das Jubiläum mit einer Reihe von Veranstaltungen begangen.