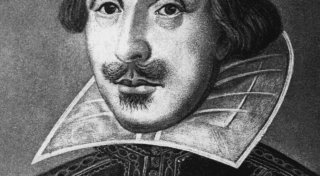Der Wilde Westen ist für mich kein Sehnsuchtsort. Er war es auch nie. Die Freiheit von Wüste, Wildnis und Whiskey wirkt in vielen Filmen und Serien zwar verlockend – doch natürlich hat die Welt vermeintlich unbegrenzter Möglichkeiten ihre Schattenseiten. Und auf die würde ich jederzeit verzichten, selbst wenn ich diese staubige Klischee-Welt betreten könnte. Denn seien wir ehrlich: Was nützt der romantische Ritt Richtung Sonnenuntergang, wenn man wenig später im Saloon als Kugelfang endet, von raubeinigen Schlägern durch die Schwingtür geworfen wird oder an einer Krankheit stirbt, für die der amerikanische Westen leider noch keine Heilung kennt. Zur vermeintlichen Romantik des Wilden Westens sage ich deswegen: Danke, aber nein danke. Es sei denn, jemand böte mir den Charme des Westens ohne seine Widrigkeiten. Mit genau diesem Szenario spielt die mit Anthony Hopkins hochkarätig besetzte Serie "Westworld" (im Streaming bei WOW und Amazon Prime Video). Die endete 2022 zwar mit der vierten Staffel, ist aber wie auch andere Produktionen zum Thema künstliche Intelligenz (KI) einen (erneuten) Blick wert. Gerade jetzt. In Kurzfassung handelt "Westworld" von einem Themenpark, in dem jeder mal völlig gefahrlos Cowboy spielen darf. Mitspieler sind neben weiteren Gästen die sogenannten Hosts, auf Deutsch: Gastgeber. Dabei handelt es sich um Roboter, die von ihrem brillant-hintergründigen Entwickler (Anthony Hopkins) so gestaltet wurden, dass sie sich von echten Menschen kaum unterscheiden lassen.
ChatGPT in Roboterköpfen
Diese Schöpfungen erfüllen verschiedene Rollen – von der Farmerstochter, über die Saloon-Dirne bis hin zum Verbrecher. Als solche gehen sie im Park ihrem programmierten Tagwerk nach. Sie arbeiten, schießen, prügeln und interagieren mit den Besuchern. Wichtig ist aber, dass per Programmierung ausgeschlossen ist, dass die Hosts Besucher verletzen oder gar töten – dafür dürfen die mit ihnen anstellen, was sie wollen. Der Park verspricht also Realitätsflucht ohne ernste Folgen und öffnet der Enthemmung die Saloon-Tür. Auf den ersten Blick wirkt die Handlung wie entrückte Fiktion. Weit hergeholt und auf spannende Weise befremdlich. Doch als ich selber anfing, die Serie zu schauen, stellte sich sehr schnell ein entgegengesetztes Gefühl ein. Eines der Nähe, fast schon der Aktualität. Ohne Zweifel liegt das an der zuletzt hitzig geführten Debatte über das Programm ChatGPT. Das lässt alle Welt staunen, weil es menschliche Sprache beinahe perfekt nachahmen kann. Ich selber ertappte mich bei dem Gedanken, dass die x-te Generation des Sprachprogramms einst in Roboterköpfe verbaut sein würde. Dann bräuchte es – überspitzt gesagt – nur noch etwas Fortschritt bei der Nachahmung von menschlichen Gesichtsausdrücken und Bewegungen und schon hieße es: Willkommen in der Westworld. Der echten. Über die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios ließe sich natürlich lange streiten. Für alle Serien-Fans ist zunächst der beschriebene Zoom-Effekt interessant: Weil die Technologie aktuell große Sprünge zu machen scheint, sehen wir Filme und Serien über KI zunehmend durch andere Augen. Die Entwicklung im echten Leben reichert die Produktionen mit Plausibilität an. In der Folge wirkt es, als beschrieben die Serien oder Filme eine irgendwie absehbare, zumindest aber durchaus vorstellbare Zukunft. Und die unterscheidet sich nicht mehr kategorisch von unserer Gegenwart, sondern nur noch dem Grad nach – zumindest scheint es so.
Das Sehvergnügen bleibt
Geht durch dieses Gefühl der Nähe Sehvergnügen verloren? Ich finde nicht. Natürlich hat es einen großen Reiz, wenn Medien mit ihren Erzählungen eine Zukunft entwerfen, die aus heutiger Sicht kaum vorstellbar ist. Ein anderes Sehvergnügen kann aber entstehen, wenn die Realität spürbar zu solchen Entwürfen aufschließt.
Doch darüber fällen Sie am besten Ihr eigenes Urteil. Schauen Sie doch mal eine Serie oder einen Film zum Thema KI ganz bewusst durch die Brille, die die Diskussion um ChatGPT uns allen aufgesetzt hat. Und dann schreiben Sie mir gerne.